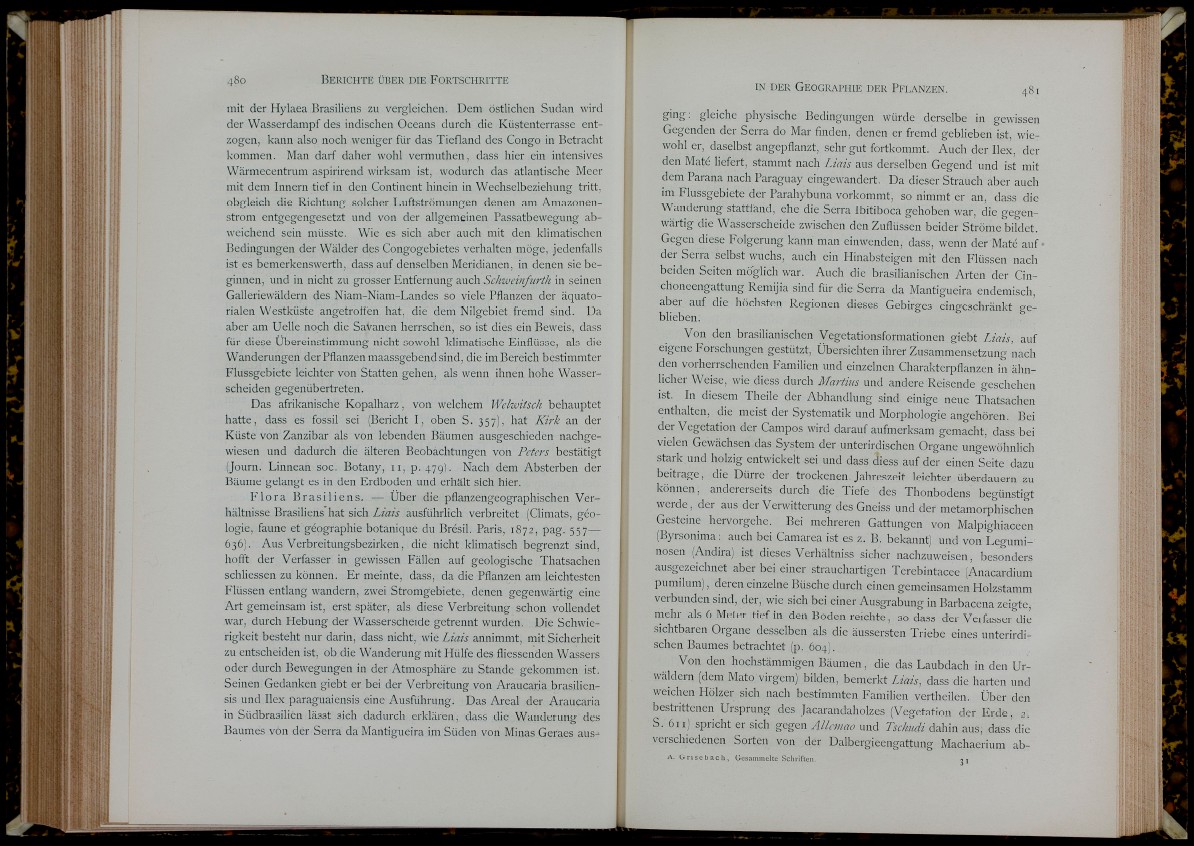
«SWS»«
H
480 BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
mit der Hylaea Brasiliens zu vergleichen. Dem östlichen Sudan wu'd
der Wasserdampf des indischen Oceans durch die Küstenterrasse entzogeuj
kann also noch weniger für das Tiefland des Congo in Betracht
kommen. Man darf daher wohl vermuthen, dass hier ein intensives
Wärmecentrum aspirirend wirksam ist^ wodurch das atlantische Meer
mit dem Innern tief in den Continent hinein in Wechselbeziehung tritt,
obgleich die Richtung solcher Luftströmungen denen am Amazonenstrom
entgegengesetzt und von der allgemeinen Passatbewegung abweichend
sein müsste. Wie es sich aber auch mit den klimatischen
Bedingungen der Wälder des Congogebietes verhalten möge, jedenfalls
ist es bemerkenswerth, dass auf denselben Meridianen, in denen sie beginnen,
und in nicht zu grosser Entfernung auch ScJviveinfurth in seinen
Galleriewäldern des Niam-Niam-Landes so viele Pflanzen der äquatorialen
Westküste aneetrofFen hat, die dem Nilgebiet fremd sind. Da
aber am Uelle noch die Savanen herrschen, so ist dies ein Beweis, dass
für diese Ubereinstimmung nicht sowohl Idimatische Einflüsse, als die
Wanderungen der Pflanzen maassgebend sind, die im Bereich bestimmter
Flussgebiete leichter von Statten gehen, als wenn ihnen hohe Wasserscheiden
gegenübertreten.
Das afrikanische Kopalharz, von welchem Welwitsch behauptet
hatte, dass es fossil sei (Bericht I, oben S. 357), hat Kirk an der
Küste von Zanzibar als von lebenden Bäumen ausgeschieden nachgewiesen
und dadurch die älteren Beobachtungen von Peters bestätigt
(Journ. Linnean soc. Botany, 11, p.479). Nach dem Absterben der
Bäume gelangt es in den Erdboden und erhält sich hier.
F l o r a Brasiliens. — Über die pflanzengeographischen Verhältnisse
Brasiliens hat sich Liais ausführlich verbreitet (Climats, géologie,
faune et géographie botanique du Brésil. Paris, 1872, pag. 557—
636). Aus Verbreitungsbezirken, die nicht klimatisch begrenzt sind,
hofft der Verfasser in gewissen Fällen auf geologische Thatsachen
schliessen zu können. Er meinte, dass, da die Pflanzen am leichtesten
Flüssen entlang wandern, zwei Stromgebiete, denen gegenwärtig eine
Art gemeinsam ist, erst später, als diese Verbreitung schon vollendet
war, durch Hebung der Wasserscheide getrennt wurden. Die Schwierigkeit
besteht nur darin, dass nicht, wie Liais annimmt, mit Sicherheit
zu entscheiden ist, ob die Wanderung mit Hülfe des fliessenden Wassers
oder durch Bewegungen in der Atmosphäre zu Stande gekommen ist.
Seinen Gedanken giebt er bei der Verbreitung von Araucaria brasiliensis
und Hex paraguaiensis eine Ausführung. Das Areal der Araucaria
in Südbrasilien lässt sich dadurch erklären, dass die Wanderune des
' o
Baumes von der Serra da Mantigueira im Süden von Minas Geraes aus^
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN.
ging: gleiche physische Bedingungen würde derselbe in gewissen
Gegenden der Serra do Mar finden, denen er fremd geblieben i.st, wiewohl
er, daselbst angepflanzt, sehr gut fortkommt. Auch der Hex, der
den Maté liefert, stammt nach Liais aus derselben Gegend und ist mit
dem Parana nach Paraguay eingewandert. Da dieser Strauch aber auch
im Flussgebiete der Parahybuna vorkommt, so nimmt er an, dass die
Wanderung stattfand, ehe die Serra Ibitiboca gehoben war, die gegenwcärtig
die Wasserscheide zwischen den Zuflüssen beider Ströme bildet.
Gegen diese Folgerung kann man einwenden, dass, wenn der Maté auf
der Serra selbst wuchs, auch ein Hinabsteigen mit den Flüssen nach
beiden Seiten möglich war. Auch die brasilianischen Arten der Cinchoneengattung
Remijia sind für die Serra da Mantigueira endemisch,
aber auf die höchsten Regionen dieses Gebirges eingeschränkt geblieben.
Von den brasilianischen Vegetationsformationen giebt Liais, auf
eigene Forschungen gestützt, Übersichten ihrer Zusammensetzung nach
den vorherrschenden Familien und einzelnen Charakterpflanzen in ähnlicher
Weise, wie diess durch Martiiis und andere Reisende geschehen
ist. In diesem Theile der Abhandlung sind einige neue Thatsachen
enthalten, die meist der Systematik und Morphologie angehören. Bei
der Vegetation der Campos wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei
vielen Gewächsen das System der unterirdischen Organe ungewöhnlich
stark und holzig entwickelt sei und dass diess auf der einen Seite dazu
beitrage, die Dürre der trockenen Jahreszeit leichter überdauern zu
können, andererseits durch die Tiefe des Thonbodens begünstigt
werde, der aus der Verwitterung des Gneiss und der metamorphischen
Gesteine hervorgehe. Bei mehreren Gattungen von Malpighiaceen
(Byrsonima: auch bei Camarea ist es z. B. bekannt) und von Leguminosen
(Andira) ist dieses Verhältniss sicher nachzuweisen, besonders
ausgezeichnet aber bei einer strauchartigen Terebintacee (Anacardium
pumilum), deren einzelne Büsche durch einen gemeinsamen Holzstamm
verbunden sind, der, wie sich bei einer Ausgrabung in Barbacena zeigte,
mehr als 6 Meter tief in den Boden reichte, so dass der Verfasser^'die
sichtbaren Organe desselben als die äussersten Triebe eines unterirdischen
Baumes betrachtet (p. 604).
Von den hochstämmigen Bäumen, die das Laubdach in den Urwäldern
(dem Mato virgem) bilden, bemerkt Liais, dass die harten und
weichen Hölzer sich nach bestimmten Familien vertheilen. Über den
bestrittenen Ursprung des Jacarandaholzes (Vegetation der Erde, 2.
S. 611) spricht er sich gegen Allcmao und Tschudi dahin aus, dass'die
verschiedenen Sorten von der Dalbergieengattung Machaerium ab-
A. G r i s e b a ch, Gesammelte Schriften.
' ñ i