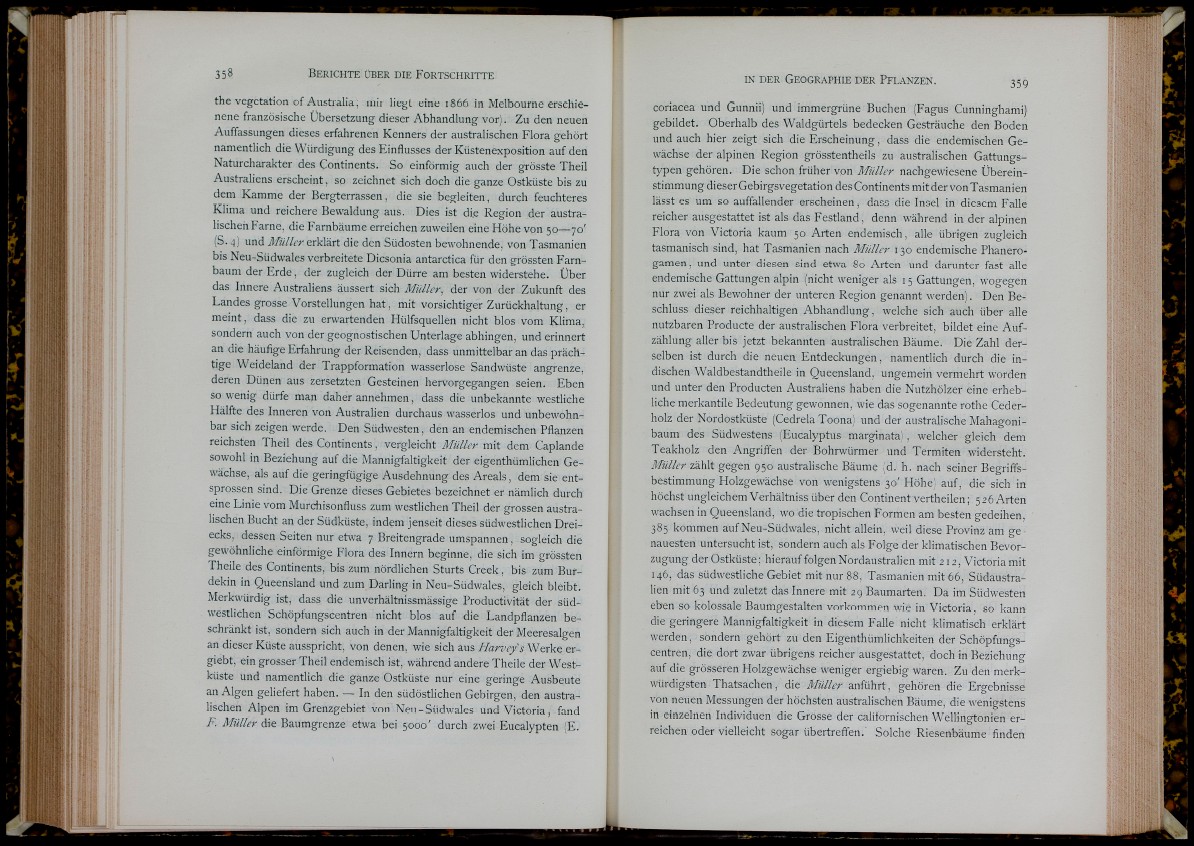
i ] 358 BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
the vegetation of Australia; mir liegt eine 1866 in Melbourne erschie--
nene französische Übersetzung dieser Abhandlung vor). Zu den neuen
Auffassungen dieses erfahrenen Kenners der australischen Flora gehört
namentlich die Würdigung des Einflusses der Küstenexposition auf den
Naturcharakter des Continents. So einförmig auch der grösste Theil
Australiens erscheint, so zeichnet sich doch die ganze Ostküste bis zu
dem Kamme der Bergterrassen, die sie begleiten, durch feuchteres
Klima und reichere Bewaldung aus. Dies ist di,e Region der australischen
Farne, die Farnbäume erreichen zuweilen eine Höhe von 50—70'
(S. 4) und Müller erklärt die den Südosten bewohnende, von Tasmanien
bis Neu-Südwales verbreitete Dicsonia antarctica für den grössten Farnbaum
der Erde, der zugleich der Dürre am besten widerstehe. Über
das Innere Australiens äussert sich Müller^ der von der Zukunft des
Landes grosse Vorstellungen hat, mit vorsichtiger Zurückhaltung, er
meint, dass die zu erwartenden Hülfsquellen nicht blos vom Klima,
sondern auch von der geognostischen Unterlage abhingen, und erinnert
an die häufige Erfahrung der Reisenden, dass unmittelbar an das prächtige
Weideland der Trappformation wasserlose Sandwüste angrenze,
deren Dünen aus zersetzten Gesteinen hervorgegangen seien. Eben
so wenig dürfe man daher annehmen, dass die unbekannte westliche
Hälfte des Inneren von Australien durchaus wasserlos und unbewohnbar
sich zeigen werde. Den Südwesten, den an endemischen Pflanzen
reichsten Theil des Continents, vergleicht Müller mit dem Caplande
sowohl in Beziehung auf die Mannigfaltigkeit der eigenthümlichen Gewächse,
als auf die geringfügige Ausdehnung des Areals, dem sie entsprossen
sind. Die Grenze dieses Gebietes bezeichnet er nämlich durch
eine Linie vom Murchisonfluss zum westlichen Theil der grossen australischen
Bucht an der Südküste, indem jenseit dieses südwestlichen Dreiecks,
dessen Seiten nur etwa 7 Breitengrade umspannen, sogleich die
gewöhnliche einförmige Flora des Innern beginne, die sich im grössten
Theile des Continents, bis zum nördlichen Sturts Creek, bis zum Bufdekin
in Queensland und zum Darling in Neu-Südwales, gleich bleibt.
Merkwürdig ist, dass die unverhältnissmässige Productivität der südwestlichen
Schöpfungscentren nicht blos auf die Landpflanzen beschränkt
ist, sondern sich auch in der Mannigfaltigkeit der Meeresalgen
an dieser Küste ausspricht, von denen, wie sich aus Harvey's Werke ergiebt,
ein grosser Theil endemisch ist, während andere Theile der Westküste
und namentlich die ganze Ostküste nur eine geringe Ausbeute
an Algen geliefert haben. — In den südöstlichen Gebirgen, den australischen
Alpen im Grenzgebiet von Neu-Südwales und Victoria, fand
F. Müller die Baumgrenze etwa bei 5000' durch zwei Eucalypten (E.
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN. 359
coriacea und Gunnii) und immergrüne Buchen (Fagus Cunninghami)
gebildet. Oberhalb des Waldgürtels bedecken Gesträuche den Boden
und auch hier zeigt sich die Erscheinung ^ dass die endemischen Gewächse
der alpinen Region grösstentheils zu australischen Gattungstypen
gehören. Die schon früher von Müller nachgewiesene Übereinstimmung
dieser Gebirgsvegetation des Continents mit der von Tasmanien
lässt es um so auffallender erscheinen, dass die Insel in diesem Falle
reicher ausgestattet ist als das Festland, denn während in der alpinen
Flora von Victoria kaum 50 Arten endemisch, alle übrigen zugleich
tasmanisch sind, hat Tasmanien nach Müller 130 endemische Phanerogamen,
und unter diesen sind etwa 80 Arten und darunter fast alle
endemische Gattungen alpin (nicht weniger als 15 Gattungen, wogegen
nur zwei als Bewohner der unteren Region genannt werden). Den Beschluss
dieser reichhaltigen Abhandlung, welche sich auch über alle
nutzbaren Producte der australischen Flora verbreitet, bildet eine Aufzählung
aller bis jetzt bekannten australischen Bäume. Die Zahl derselben
ist durch die neuen Entdeckungen, namentlich durch die indischen
Waldbestandtheile in Queensland, ungemein vermehrt worden
und unter den Producten Australiens haben die Nutzhölzer eine erhebliche
merkantile Bedeutung gewonnen, wie das sogenannte rothe Cederholz
der Nordostküste (Cedrela Toona) und der australische Mahagonibaum
des Südwestens (Eucalyptus marginata) , welcher gleich dem
Teakholz den Angriffen der Bohrwürmer und Termiten widersteht.
Müller zählt gegen 950 australische Bäume (d. h. nach seiner Begriffsbestimmung
Holzgewächse von wenigstens 30' Höhe) auf, die sich in
höchst ungleichem Verhältniss über den Continent vertheilen; 5 2 6 Arten
wachsen in Queensland, wo die tropischen Formen am besten gedeihen
385 kommen auf Neu-Südwales, nicht allein, weil diese Provinz am genauesten
untersucht ist, sondern auch als Folge der klimatischen Bevorzugung
der Ostküste; hierauf folgen Nordaustralien mit 212, Victoria mit
146, das südwestliche Gebiet mit nur 88, Tasmanien mit 66, Südaustralien
mit 63 und zuletzt das Innere mit 29 Baumarten. Da im Südwesten
eben so kolossale Baumgestalten vorkommen wie in Victoria, so kann
die geringere Mannigfaltigkeit in diesem Falle nicht klimatisch erklärt
werden, sondern gehört zu den Eigenthümlichkeiten der Schöpfungscentren,
die dort zwar übrigens reicher ausgestattet, doch in Beziehung
auf die grösseren Holzgewächse weniger ergiebig waren. Zu den merkwürdigsten
Thatsachen, die Müller anführt, gehören die Ergebnisse
von neuen Messungen der höchsten australischen Bäume, die wenigstens
in einzelnen Individuen die Grösse der californischen WeUingtonien erreichen
oder vielleicht sogar übertreffen.' Solche Riesenbäume finden
I
mmit
sri I
( I
' ''
i