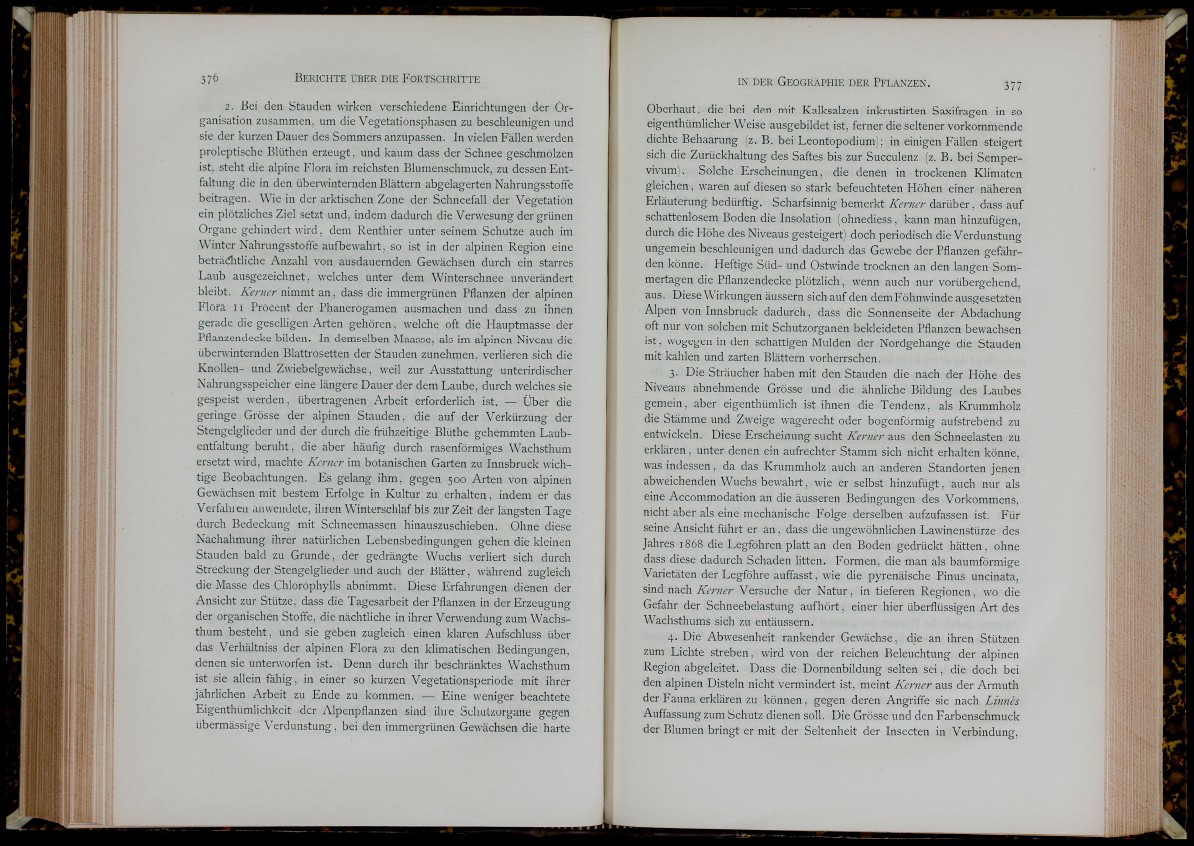
Z I r", Hii^i:
.. .w r- ^ •
i f^r
I i:
Ui
376 BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
2. Bei den Stauden wirken verschiedene Einrichtungen der Organisation
zusammen, um die Vegetationsphasen zu beschleunigen und
sie der kurzen Dauer des Sommers anzupassen. In vielen Fällen werden
proleptische Blüthen erzeugt, und kaum dass der Schnee geschmolzen
ist, steht die alpine Flora im reichsten Blumenschmuck, zu dessen Entfaltung
die in den überwinternden Blättern abgelagerten Nahrungsstoffe
beitragen. Wie in der arktischen Zone der Schneefall der Vegetation
ein plötzliches Ziel setzt und, indem dadurch die Verwesung der grünen
Organe gehindert wird, dem Renthier unter seinem Schutze auch im
Winter Nahrungsstoffe aufbewahrt, so ist in der alpinen Region eine
beträditliche Anzahl von ausdauernden Gewächsen durch ein starres
Laub ausgezeichnet, welches unter dem Winterschnee unverändert
bleibt. Kerncr nimmt an, dass die immergrünen Pflanzen der alpinen
Flora 11 Procent der Phanerogamen ausmachen und dass zu ihnen
gerade die geselligen Arten gehören, welche oft die Hauptmasse der
Pflanzendecke bilden. In demselben Maasse, als im alpinen Niveau die
überwinternden Blattrosetten der Stauden zunehmen, verlieren sich die
Knollen- und Zwiebelgewächse, weil zur Ausstattung unterirdischer
Nahrungsspeicher eine längere Dauer der dem Laube, durch welches sie
gespeist werden, übertragenen Arbeit erforderiich ist. — Über die
geringe - Grösse der alpinen Stauden, die auf der Verkürzung der
Stengelglieder und der durch die frühzeitige Blüthe gehemmten Laubentfaltung
beruht, die aber häufig durch rasenförmiges Wachsthum
ersetzt wird^ machte Kerncr im botanischen Garten zu Innsbruck wichtige
Beobachtungen. Es gelang ihm, gegen 500 Arten von alpinen
Gewächsen mit bestem Erfolge in Kultur zu erhalten, indem er das
Verfahren anwendete, ihren Winterschlaf bis zur Zeit der längsten Tage
durch Bedeckung mit Schneemassen hinauszuschieben. Ohne diese
Nachahmung ihrer natürlichen Lebensbedingungen gehen die kleinen
Stauden bald zu Grunde, der gedrängte Wuchs verhert sich durch
Streckung der Stengelglieder und auch der Blätter, während zugleich
die Masse des Chlorophylls abnimmt. Diese Erfahrungen dienen der
Ansicht zur Stütze; dass die Tagesarbeit der Pflanzen in der Erzeugung
der organischen Stoffe, die nächtliche in ihrer Verwendung zum Wachsthum
besteht, und sie geben zugleich einen klaren Aufschluss über
das Verhältniss der alpinen Flora zu den klimatischen Bedingungen,
denen sie unterworfen ist. Denn durch ihr beschränktes Wachsthum
ist sie allein fähig, in einer so kurzen Vegetationsperiode mit ihrer
jährlichen Arbeit zu Ende zu kommen. — Eine weniger beachtete
Eigenthümlichkeit der Alpenpflanzen sind ihre Schutzorgane gegen
übermässige Verdunstung, bei den immergrünen Gewächsen die"harte
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN. 377
Oberhaut, die bei den mit Kalksalzen inkrustirten Saxifragen in so
eigenthümlicher Weise ausgebildet ist, ferner die seltener vorkommende
dichte Behaarung (z. B. bei Leontopodium); in einigen Fällen steigert
sich die Zurückhaltung des Saftes bis zur Succulenz (z. B. bei Sempervivum).
Solche Erscheinungen, die denen in trockenen Klimaten
gleichen, waren auf diesen so stark befeuchteten Höhen einer näheren
Erläuterung bedürftig. Scharfsinnig bemerkt Kerner darüber, dass auf
schattenlosem Boden die Insolation (ohnediess, kann man hinzufügen,
durch die Höhe des Niveaus gesteigert) doch periodisch die Verdunstung
ungemein beschleunigen und dadurch das Gewebe der Pflanzen gefährden
könne. Heftige Süd- und Ostwinde trocknen an den langen Sommertagen
die Pflanzendecke plötzlich, wenn auch nur vorübergehend,
aus. Diese Wirkungen äussern sich auf den dem Föhnwinde ausgesetzten
Alpen von Innsbruck dadurch, dass die Sonnenseite der Abdachung
oft nur von solchen mit Schutzorganen bekleideten Pflanzen bewachsen
ist, wogegen in den schattigen Mulden der Nordgehänge die Stauden
mit kahlen und zarten Blättern vorherrschen.
3. Die Sträucher haben mit den Stauden die nach der Höhe des
Niveaus abnehmende Grösse und die ähnliche Bildung des Laubes
gemein, aber eigenthümlich ist ihnen die Tendenz, als Krummholz
die Stämme und Zweige wagerecht oder bogenförmig aufstrebend zu
entwickeln. Diese Erscheinung sucht Kerner aus den Schneelasten zu
erklären, unter denen ein aufrechter Stamm sich nicht erhalten könne,
was indessen, da das Krummholz auch an anderen Standorten jenen
abweichenden Wuchs bewahrt, wie er selbst hinzufügt, auch nur als
eine Accommodation an die äusseren Bedingungen des Vorkommens,
nicht aber als eine mechanische Folge derselben aufzufassen ist. Für
seine Ansicht führt er an, dass die ungewöhnlichen Lawinenstürze des
Jahres 1868 die Legföhren platt an den Boden gedrückt hätten, ohne
dass diese dadurch Schaden litten. Formen, die man als baumförmige
Varietäten der Legföhre auffasst, wie die pyrenäische Pinus uncinata,
sind nach Kerner Versuche der Natur, in tieferen Regionen, wo die
Gefahr der Schneebelastung aufhört, einer hier überflüssigen Art des
Wachsthums sich zu entäussern.
4. Die Abwesenheit rankender Gewächse, die an ihren Stützen
zum Lichte streben, wird von der reichen Beleuchtung der alpinen
Region abgeleitet. Dass die Dornenbildung selten sei, die doch bei
den alpinen Disteln nicht vermindert ist, meint Kerner aus der Armuth
der Fauna erklären zu können, gegen deren Angriffe sie nach Linnes
Auffassung zum Schutz dienen soll. Die Grösse und den Farbenschmuck
der Blumen bringt er mit der Seltenheit der Insecten in Verbindung,
Ii m
i
iL
iKli
l ' l j u l i '
' I . I i ;•i j
•I; ipf
m