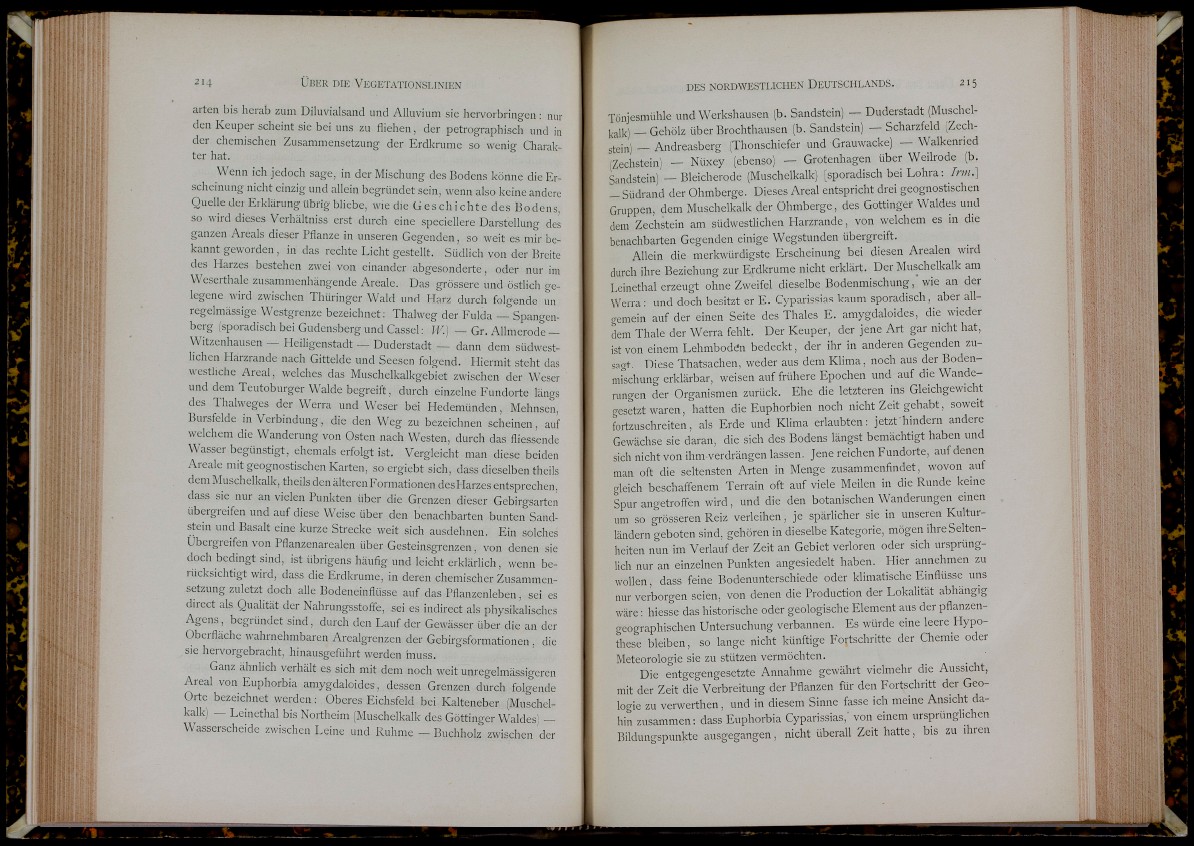
t
l:
Vi
214 ÜBER DIE VEGETATIONSIJNIEN
arten bis herab zum Diluvialsand und Alluvium sie hervorbringen: nur
den Keuper scheint sie bei uns zu fliehen, der petrographisch und in
der chemischen Zusammensetzung der Erdkrume so wenig Charakter
hat.
Wenn ich jedoch sage, in der Mischung des Bodens könne die Erscheinung
nicht einzig und allein begründet sein, wenn also keine andere
Quelle der Erklärung übrig bliebe, wie die G e s c h i c h t e des Bodens,
so wird dieses Verhältniss erst durch eine speciellere Darstellung des
ganzen Areals dieser Pflanze in unseren Gegenden, so weit es mir bekannt
geworden , in das rechte Licht gestellt. Südlich von der Breite
des Harzes bestehen zwei von einander abgesonderte, oder nur im
VVeserthale zusammenhängende Areale. Das grössere und östlich gelegene
wird zwischen Thüringer Wald und Harz durch folgende unregelmässige
Westgrenze bezeichnet: Thalweg der Fulda — Spangenberg
(sporadisch bei Gudensberg und Cassel: W.) — Gr. Allmerode —
Witzenhausen — Heiligenstadt — Duderstadt — dann dem südwestlichen
Harzrande nach Gittelde und Seesen folgend. Hiermit steht das
westliche Areal, welches das Muschelkalkgebiet zwischen der Weser
und dem Teutoburger Walde begreift, durch einzelne Fundorte längs
des Thalweges der Werra und Weser bei Hedemünden, Mehnsen,
Bursfelde in Verbindung, die den Weg zu bezeichnen scheinen, auf
welchem die Wanderung von Osten nach Westen, durch das fliessende
Wasser begünstigt, ehemals erfolgt ist. Vergleicht man diese beiden
Areale mit geognostischen Karten, so ergiebt sich, dass dieselben theils
dem Muschelkalk, theils den älteren Formationen des Harzes entsprechen,
dass sie nur an vielen Punkten über die Grenzen dieser Gebirgsarten
übergreifen und auf diese Weise über den benachbarten bunten Sandstein
und Basalt eine kurze Strecke weit sich ausdehnen. Ein solches
Ubergreifen von Pflanzenarealen über Gesteinsgrenzen, von denen sie
doch bedingt sind, ist übrigens häufig und leicht erklärlich, wenn berücksichtigt
wird, dass die Erdkrume, in deren chemischer Zusammensetzung
zuletzt doch alle Bodeneinflüsse auf das Pflanzenleben, sei es
direct als Qualität der Nahrungsstofife, sei es indirect als physikalisches
Agens, begründet sind, durch den Lauf der Gewässer über die an der
Oberfläche wahrnehmbaren Arealgrenzen der Gebirgsformationen , die
sie hervorgebracht, hinausgeführt werden muss.
Ganz ähnlich verhält es sich mit dem noch weit unregelmässigeren
Areal von Euphorbia amygdaloides, dessen Grenzen durch folgende
Orte bezeichnet werden: Oberes Eichsfeld bei Kalteneber (Muschelkalk)
— Leinethal bis Northeim (Muschelkalk des Göttinger Waldes) —
Wasserscheide zwischen Leine und Ruhme - Buchholz zwischen der
DES NORDWESTLICHEN DEUTSCHLANDS, 215
Tönjesmühle und Werkshausen (b. Sandstein) — Duderstadt (Muschell,
alk) — Gehölz über Brochthausen (b. Sandstein) — Scharzfeld (Zechstein)
— Andreasberg (Thonschiefer und Grauwacke) — Walkenned
(Zechstein) — Nüxey (ebenso) — Grotenhagen über Weilrode (b.
Sandstein) — Bleicherode (Muschelkalk) [sporadisch bei Lohra : /rw.]
I Südrand der Ohmberge. Dieses Areal entspricht drei geognostischen
Gruppen, dem Muschelkalk der Ohmberge, des Göttinger Waldes und
dem Zechstein am südwestlichen Harzrande, von welchem es in die
benachbarten Gegenden einige Wegstunden übergreift.
Allein die merkwürdigste Erscheinung bei diesen Arealen wird
durch ihre Beziehung zur Erdkrume nicht erklärt. Der Muschelkalk am
Leinethal erzeugt ohne Zweifel dieselbe Bodenmischung, wie an der
Werra: und doch besitzt er E. Cyparissias kaum sporadisch, aber allcremein
auf der einen Seite des Thaies E. amygdaloides, die wieder
dem Thale der Werra fehlt. Der Keuper, der jene Art gar nicht hat,
ist von einem Lehmboden bedeckt, der ihr in anderen Gegenden zusagt.
Diese Thatsachen, weder aus dem Klima, noch aus der Bodenmischung
erklärbar, weisen auf frühere Epochen und auf die Wanderungen
der Organismen zurück. Ehe die letzteren ins Gleichgewicht
gesetzt waren, hatten die Euphorbien noch nicht Zeit gehabt, soweit
fortzuschreiten, als Erde und Klima erlaubten: jetzt hindern andere
Gewächse sie daran, die sich des Bodens längst bemächtigt haben und
sich nicht von ihm verdrängen lassen. Jene reichen Fundorte, auf denen
man oft die seltensten Arten in Menge zusammenfindet, wovon auf
gleich beschaffenem Terrain oft auf viele Meilen in die Runde keine
Spur angetroffen wird, und die den botanischen Wanderungen einen
um so grösseren Reiz verleihen, je spärlicher sie in unseren Kulturländern
geboten sind, gehören in dieselbe Kategorie, mögen ihre Seltenheiten
nun im Verlauf der Zeit an Gebiet verloren oder sich ursprünglich
nur an einzelnen Punkten angesiedelt haben. Hier annehmen zu
wollen, dass feine Bodenunterschiede oder klimatische Einflüsse uns
nur verborgen seien, von denen die Production der Lokalität abhängig
wäre : hiesse das historische oder geologische Element aus der pflanzengeographischen
Untersuchung verbannen. Es würde eine leere Hypothese
bleiben, so lange nicht künftige Fortschritte der Chemie oder
Meteorologie sie zu stützen vermöchten.
Die entgegengesetzte Annahme gewährt vielmehr die Aussicht,
mit der Zeit die Verbreitung der Pflanzen für den Fortschritt der Geologie
zu verwerthen, und in diesem Sinne fasse ich meine Ansicht dahin
zusammen: dass Euphorbia Cyparissias,' von einem ursprünglichen
Bildungspunkte ausgegangen, nicht überall Zeit hatte, bis zu ihren
i S i i ï
il
l^inwaitii
Ii»
i S
I 1
i l ^ i
,•1
ûfetiîii