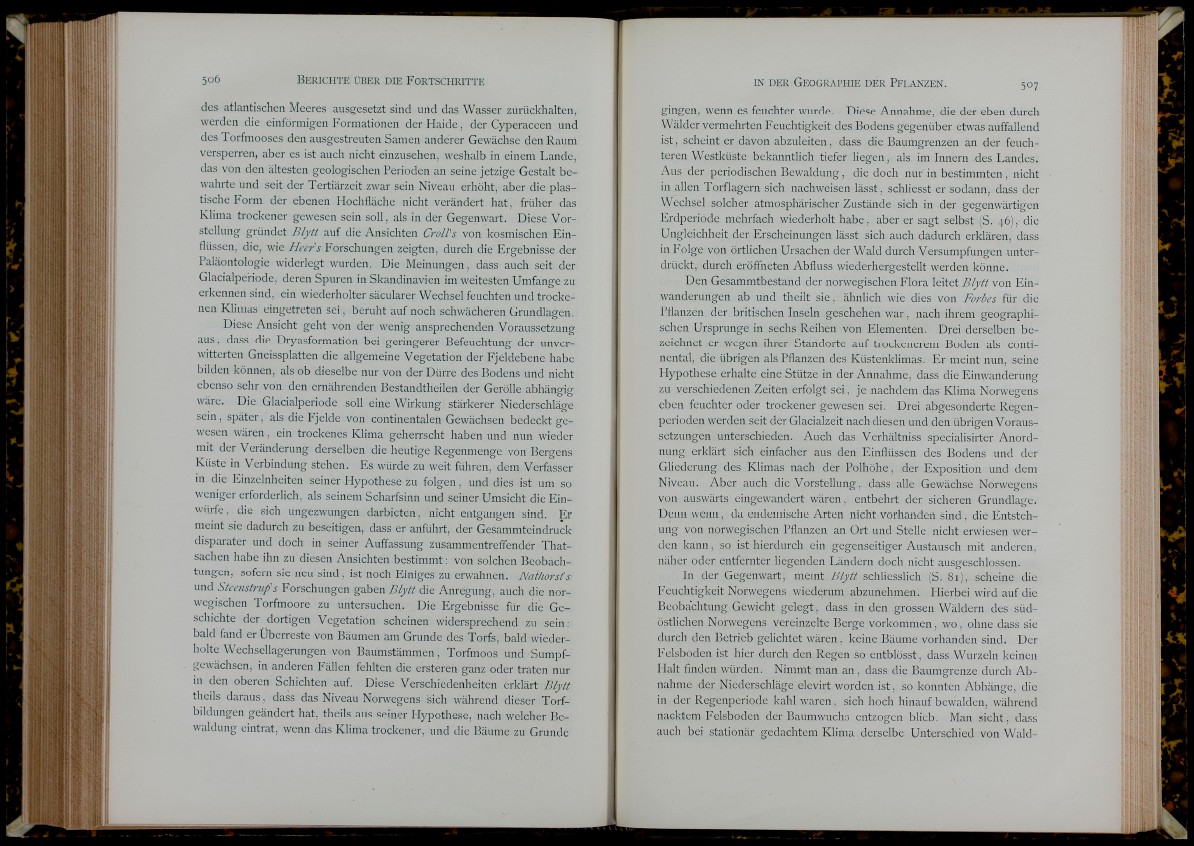
I
Ii
506 BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
des atlantischen Meeres ausgesetzt sind und das Wasser zurückhalten,
werden die einförmigen Formationen der Haide, der Cyperaceen und
des Torfmooses den ausgestreuten Samen anderer Gewächse den Raum
versperren, aber es ist auch nicht einzusehen, weshalb in einem Lande,
das von den ältesten geologischen Perioden an seine jetzige Gestalt bewahrte
und seit der Tertiärzeit zwar sein Niveau erhöht, aber die plastische
Form der ebenen Hochfläche nicht verändert hat, früher das
Klima trockener gewesen sein soll, als in der Gegenwart. Diese Vorstellung
gründet Blytt auf die Ansichten CroWs von kosmischen Einflüssen,
die, wie Heers Forschungen zeigten, durch die Ergebnisse der
Paläontologie widerlegt wurden. Die Meinungen, dass auch seit der
Glacialperiode, deren Spuren in Skandinavien im weitesten Umfange zu
erkennen sind, ein wiederholter säcularer Wechsel feuchten und trockenen
Klimas eingetreten sei, beruht auf noch schwächeren Grundlagen.
Diese Ansicht geht von der wenig ansprechenden Voraussetzung
aus, dass die Dryasformation bei geringerer Befeuchtung der unverwitterten
Gneissplatten die allgemeine Vegetation der Fjeldebene habe
bilden können, als ob dieselbe nur von der Dürre des Bodens und nicht
ebenso sehr von den ernährenden Bestandtheilen der Gerölle abhängig
wäre. Die Glacialperiode soll eine Wirkung stärkerer Niederschläge
sein, später, als die Fjelde von continentalen Gewächsen bedeckt gewesen
wären, ein trockenes Klima geherrscht haben und nun wieder
mit der Veränderung derselben die heutige Regenmenge von Bergens
Küste in Verbindung stehen. Es würde zu weit führen, dem Verfasser
in die Einzelnheiten seiner Hypothese zu folgen, und dies ist um so
weniger erforderlich, als seinem Scharfsinn und seiner Umsicht die Einwürfe
, die sich ungezwungen darbieten, nicht entgangen sind. Er
meint sie dadurch zu beseitigen, dass er anführt, der Gesammteindruck
disparater und doch in seiner Auffassung zusammentrefTender Thatsachen
habe ihn zu diesen Ansichten bestimmt: von solchen Beobachtungen,
sofern sie neu sind, ist noch Einiges zu erwähnen. Nathorsts
und Steenslrufs Forschungen gaben Blytt die Anregung, auch die norwegischen
Torfmoore zu untersuchen. Die Ergebnisse Rir die Geschichte
der_ dortigen Vegetation scheinen widersprechend zu sein:
bald fand er Überreste von Bäumen am Grunde des Torfs, bald wiederholte
Wechsellagerungen von Baumstämmen, Torfmoos und Sumpfgewächsen,
in anderen Fällen fehlten die ersteren ganz oder traten nur
in den oberen Schichten auf. Diese Verschiedenheiten erklärt Blytt
theils daraus, dass das Niveau Norwegens sich während dieser Torfbildungen
geändert hat, theils aus seiner Hypothese, nach welcher Bewaldung
eintrat, wenn das Klima trockener, und die Bäume zu Grunde
f !
^ ri
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN. 507
gingen, wenn es feuchter wurde. Diese Annahme, die der eben durch
Wälder vermehrten Feuchtigkeit des Bodens gegenüber etwas auffallend
ist, scheint er davon abzuleiten, dass die Baumgrenzen an der feuchteren
Westküste bekannthch tiefer liegen, als im Innern des Landes.
Aus der periodischen Bewaldung, die doch nur in bestimmten, nicht
in allen Torflagern sich nachweisen lässt, schliesst er sodann, dass der
Wechsel solcher atmosphärischer Zustände sich in der gegenwärtigen
Erdperiode mehrfach wiederholt habe, aber er sagt selbst (S. 46), die
Ungleichheit der Erscheinungen lässt sich auch dadurch erklären, dass
in Folge von örtlichen Ursachen der Wald durch Versumpfungen unterdrückt,
durch eröffneten Abfluss wiederhergestellt werden könne.
Den Gesammtbestand der norwegischen Flora leitet Blytt von Einwanderungen
ab und theilt sie, ähnlich wie dies von Forbes für die
Pflanzen der britischen Inseln geschehen war, nach ihrem geographischen
Ursprünge in sechs Reihen von Elementen. Drei derselben bezeichnet
er wegen ihrer Standorte auf trockenerem Boden als Continental,
die übrigen als Pflanzen des Küstenklimas. Er meint nun, seine
Hypothese erhalte eine Stütze in der Annahme, dass die Einwanderung
zu verschiedenen Zeiten erfolgt sei, je nachdem das Klima Norwegens
eben feuchter oder trockener gewesen sei. Drei abgesonderte Regenperioden
werden seit der Glacialzeit nach diesen und den übrigen Voraussetzungen
unterschieden. Auch das Verhältniss specialisirter Anordnung
erklärt sich einfacher aus den Einflüssen des Bodens und der
Ghederung des KUmas nach der Polhöhe, der Exposition und dem
Niveau. Aber auch die Vorstellung, dass alle Gewächse Norwegens
von auswärts eingewandert wären, entbehrt der sicheren Grundlage.
Denn wenn, da endemische Arten nicht vorhanden sind , die Entstehung
von norwegischen Pflanzen an Ort und Stelle nicht erwiesen werden
kann, so ist hierdurch ein gegenseitiger Austausch mit anderen,
näher oder entfernter hegenden Ländern doch nicht ausgeschlossen.
In der Gegenwart, meint Blytt schliesslich (S. 81), scheine die
Feuchtigkeit Norwegens wiederum abzunehmen. Hierbei wird auf die
Beobachtung Gewicht gelegt, dass in den grossen Wäldern des südöstUchen
Norwegens vereinzelte Berge vorkommen, wo, ohne dass sie
durch den Betrieb gelichtet wären, keine Bäume vorhanden sind. Der
F'elsboden ist hier durch den Regen so entblösst, dass Wurzeln keinen
Halt finden würden. Nimmt man an, dass die Baumgrenze durch Abnahme
der Niederschläge elevirt worden ist, so konnten Abhänge, die
in der Regenperiode kahl waren, sich hoch hinauf bewalden, während
nacktem Felsboden der Baumwuchs entzogen bheb. Man sieht, dass
auch bei stationär gedachtem Klima derselbe Unterschied von Waldau
iiii
EI