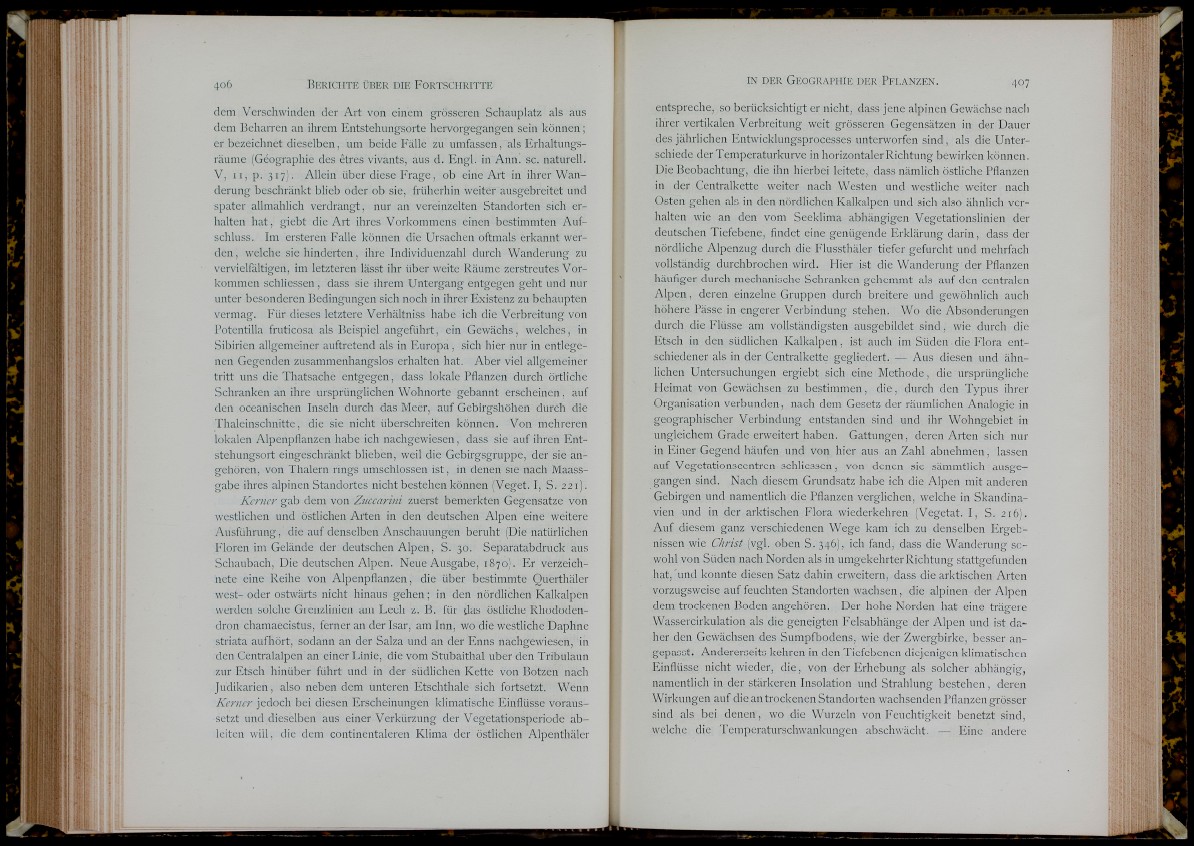
r^îf
i ^^iî
¡fJïî
• i • - I
. ¿ f i l
\ rliff""
I 0 I Kk. IBi ra.
m
nhii".". it
406 BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
dem Verschwinden der Art von einem grösseren Schauplatz als aus
dem Beharren an ihrem Entstehungsorte hervorgegangen sein können ;
er bezeichnet dieselben, um beide Fälle zu umfassen, als Erhaltungsräume
(Géographie des êtres vivants, aus d. Engl, in Ann. sc. naturell.
V, II, p. 317). Allein über diese Frage, ob eine Art in ihrer Wanderung
beschränkt blieb oder ob sie, früherhin weiter ausgebreitet und
später allmählich verdrängt, nur an vereinzelten Standorten sich erhalten
hat, giebt die Art ihres Vorkommens einen bestimmten Aufschluss.
Im ersteren Falle können die Ursachen oftmals erkannt werden
, welche sie hinderten, ihre Individuenzahl durch Wanderung zu
vervielfältigen, im letzteren lässt ihr über weite Räume zerstreutes Vorkommen
schliessen , deiss sie ihrem Untergang entgegen geht und nur
unter besonderen Bedingungen sich noch in ihrer Existenz zu behaupten
vermag. Für dieses letztere Verhältniss habe ich die Verbreitung von
Potentilla fruticosa als lieispiel angeführt, ein Gewächs, welches, in
Sibirien allgemeiner auftretend als in Europa, sich hier nur in entlegenen
Gegenden zusammenhangslos erhalten hat. Aber viel allgemeiner
tritt uns die Thatsache entgegen, dass lokale Pflanzen durch örtliche
Schranken an ihre ursprünglichen Wohnorte gebannt erscheinen, auf
den oceanischen Inseln durch das Meer, auf Gebirgshöhen durch die
Thaleinschnitte, die sie nicht überschreiten können. Von mehreren
lokalen Alpenpflanzen habe ich nachgewiesen, dass sie auf ihren Entstehungsort
eingeschränkt blieben, weil die Gebirgsgruppe, der sie angehören,
von Thälern rings uinschlossen ist, in denen sie nach Maassgabe
ihres alpinen Standortes nicht bestehen können (Veget. I, S. 221).
Kcrncr gab dem von Zuccm'ini zuerst bemerkten Gegensatze von
westUchen und östlichen Arten in den deutschen Alpen eine weitere
Ausführung, die auf denselben Anschauungen beruht (Die natürlichen
Floren im Gelände der deutschen Alpen, S. 30. Separatabdruck aus
Schaubach, Die deutschen Alpen. Neue Ausgabe, 1870). Er verzeichnete
eine Reihe von Alpenpflanzen, die über bestimmte Querthäler
west- oder ostwärts nicht hinaus gehen ; in den nördlichen Kalkalpen
werden solche Grenzlinien am Lech z. B. für çlas östliche Rhododendron
chamaecistus, ferner an der Isar, am Inn, wo die westliche Daphne
striata aufhört, sodann an der Salza und an der Enns nachgewiesen, in
den Centralalpen an einer Linie, die vom Stubaithal über den Tribulaun
zur Etsch hinüber führt und in der südlichen Kette von Bötzen nach
Judikarien, also neben dem unteren Etschthale sich fortsetzt. Wenn
Kcrncr jedoch bei diesen Erscheinungen klimatische Einflüsse voraussetzt
und dieselben aus einer Verkürzung der Vegetationsperiode ableiten
will, die dem continentaleren Klima der östlichen Alpenthäler
IN DER GEOGRAPHIE DKK PFIANZEN.
entspreche, so berücksichtigt er nicht, dass jene alpinen Gewächse nach
ihrer vertikalen Verbreitung weit grösseren Gegensätzen in der Dauer
des jährhchen Entwicklungsprocesses unterworfen sind, als die Unterschiede
der Temperaturkurve in horizontaler Richtung bewirken können.
Die Beobachtung, die ihn hierbei leitete, dass nämlich östliche Pflanzen
in der Centraikette weiter nach Westen und westliche weiter nach
Osten gehen als in den nördlichen Kalkalpen und sich also ähnlich verhalten
wie an den vom Seeklima abhängigen Vegetationslinien der
deutschen Tiefebene, findet eine genügende Erklärung darin, dass der
nördliche Alpenzug durch die Flussthäler tiefer gefurcht und mehrfach
vollständig durchbrochen wird. Hier ist die Wanderung der Pflanzen
häufiger durch mechanische Schranken gehemmt als auf den centralen
Alpen, deren einzelne Gruppen durch breitere und gewöhnlich auch
höhere Pässe in engerer Verbindung stehen. Wo die Absonderungen
durch die Flüsse am vollständigsten ausgebildet sind, wie durch die
Etsch in den südlichen Kalkalpen, ist auch im Süden die Flora entschiedener
als in der Centraikette gegliedert. — Aus diesen und ähnlichen
Untersuchungen ergiebt sich eine Methode, die ursprüngliche
Heimat von Gewächsen zu bestimmen, die, durch den Typus ihrer
Organisation verbunden, nach dem Gesetz der räumlichen Analogie in
geographischer Verbindung entstanden sind und ihr Wohngebiet in
ungleichem Grade erweitert haben. Gattungen, deren Arten sich nur
in Einer Gegend häufen und von hier aus an Zahl abnehmen, lassen
auf Vegetationscentren schliessen, von denen sie sämmtlich ausgegangen
sind. Nach diesem Grundsatz habe ich die Alpen mit anderen
Gebirgen und namentlich die Pflanzen verglichen, welche in Skandinavien
und in der arktischen Flora wiederkehren (Vegetat. I, S. 216).
Auf diesem ganz verschiedenen Wege kam ich zu denselben Ergebnissen
wie Christ (vgl. oben S. 346), ich fand, dass die Wanderung sowohl
von Süden nach Norden als in umgekehrter Richtung stattgefunden
hat, "und konnte diesen Satz dahin erweitern, dass die arktischen Arten
vorzugsweise auf feuchten Standorten wachsen, die alpinen der Alpen
dem trockenen Boden angehören. Der hohe Norden hat eine trägere
Wassercirkulation als die geneigten Felsabhänge der Alpen und ist daher
den Gewächsen des Sumpfbodens, wie der Zwergbirke, besser angepasst.
Andererseits kehren in den Tiefebenen diejenigen klimatischen
Einflüsse nicht wieder, die, von der Erhebung als solcher abhängig,
namentlich in der stärkeren Insolation und Strahlung bestehen, deren
Wirkungen auf die an trockenen Standorten wachsenden Pflanzen grösser
sind als bei denen, wo die Wurzeln von Feuchtigkeit benetzt sind,
welche die Temperaturschwankungen abschwächt. — P^ine andere
U !
M
1> S