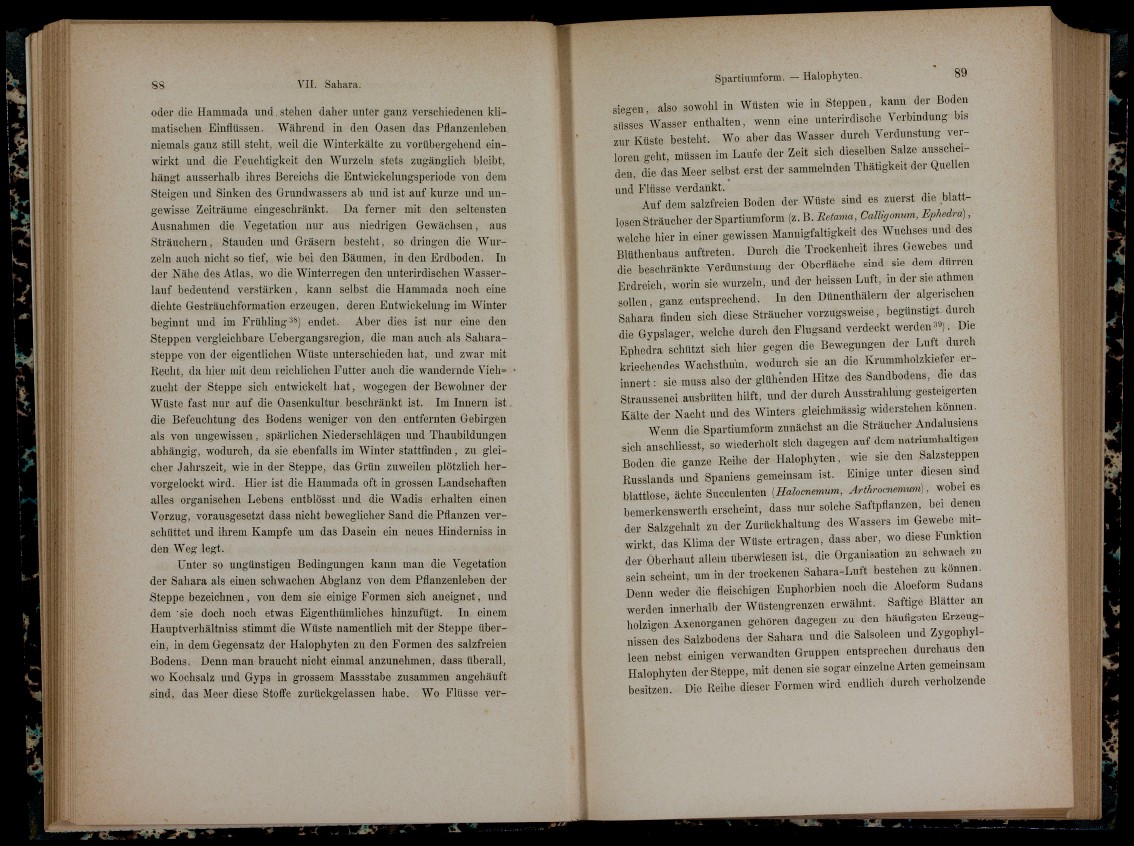
, . I i"' ' :
88 VII. Sahara. Spartiiimform. — Halophyten. 89
: : i.
< K t"
A
oder die Hammada und.stehen daher unter ganz verschiedenen klimatischen
Einflüssen. Während in den Oasen das Pflanzenleben
niemals ganz still steht, weil die Winterkälte zu vorübergehend einwirkt
und die Feuchtigkeit den Wurzeln stets zugänglich bleibt,
hängt ausserhalb ihres Bereichs die Entwickelungsperiode von dem
Steigen und Sinken des Grundwassers ab und ist auf kurze und ungewisse
Zeiträume eingeschränkt. Da ferner mit den seltensten
Ausnahmen die Vegetation nur aus niedrigen Gewächsen, aus
Sträuchern, Stauden und Gräsern besteht, so dringen die Wurzeln
auch nicht so tief, wie bei den Bäumen, in den Erdboden. In
der Nähe des Atlas, wo die Winterregen den unterirdischen Wasserlauf
bedeutend verstärken, kann selbst die Hammada noch eine
dichte Gesträuchformation erzeugen, deren Entwickelung im Winter
beginnt und im Frühling endet. Aber dies ist nur eine den
Steppen vergleichbare Uebergangsregion, die man auch als Saharasteppe
von der eigentlichen Wüste unterschieden hat, und zwar mit
Recht, da hier mit dem reichlichen Futter auch die wandernde Viehzucht
der Steppe sich entwickelt hat, wogegen der Bewohner der
Wüste fast nur auf die Oasenkultur beschränkt ist. Im Innern ist
die Befeuchtung des Bodens weniger von den entfernten Gebirgen
als von ungewissen, spärlichen Niederschlägen und Thaubildungen
abhängig, wodurch, da sie ebenfalls im Winter stattfinden, zu gleicher
Jahrszeit, wie in der Steppe, das Grün zuweilen plötzlich hervorgelockt
wird. Hier ist die Hammada oft in grossen Landschaften
alles organischen Lebens entblösst und die Wadis erhalten einen
Vorzug, vorausgesetzt dass nicht beweglicher Sand die Pflanzen verschüttet
und ihrem Kampfe um das Dasein ein neues Hinderniss in
den Weg legt.
Unter so ungünstigen Bedingungen kann man die Vegetation
der Sahara als einen schwachen Abglanz von dem Pflanzenleben der
Steppe bezeichnen, von dem sie einige Formen sich aneignet, und
dem 'sie doch noch etwas Eigenthümliches hinzufügt. In einem
Hauptverhältniss stimmt die Wüste namentlich mit der Steppe überein,
in dem Gegensatz der Halophyten zu den Formen des salzfreien
Bodens. Denn man braucht nicht einmal anzunehmen, dass überall,
wo Kochsalz und Gyps in grossem Massstabe zusammen angehäuft
sind, das Meer diese Stoffe zurückgelassen habe. Wo Flüsse versieo
en also sowohl in Wüsten wie in Steppen, kann der Boden
süsses Wasser enthalten, wenn eine unterirdische Verbindung bis
zur Küste besteht. Wo aber das Wasser durch Verdunstung verloren
geht, müssen im Laufe der Zeit sich dieselben Salze ausscheiden,
die das Meer selbst erst der sammelnden Thätigkeit der Quellen
und Flüsse verdankt.
Auf dem salzfreien Boden der Wüste sind es zuerst die blattlosen
Sträucher der Spartiumform (z.B. Retama, Calligonum, Ephedra),
welche hier in einer gewissen Mannigfaltigkeit des Wuchses und des
Blüthenbaus auftreten. Durch die Trockenheit ihres Gewebes und
die beschränkte Verdunstiing der Oberfläche sind sie dem dürren
Erdreich, worin sie wurzeln, und der heissen Luft, in der sie athmen
sollen ganz entsprechend. In den Dünenthälern der algerischen
Saharl finden sich d i e s e Sträucher vorzugsweise, begünstigt durch
die Gypslager, welche durch den Flugsand verdeckt werden 39). Die
Ephedra schützt sich hier gegen die Bewegungen der Luft durch
kriechendes Wachsthum, wodurch sie an die Krummholzkiefer erinnert
• sie muss also der glühbden Hitze des Sandbodens, die das
Straussenei ausbrüten hilft, und der durch Ausstrahlung gesteigerten
Kälte der Nacht und des Winters gleichmässig widerstehen können.
Wenn die Spartiumform zunächst an die Sträucher Andalusiens
sich anschliesst, so wiederholt sich dagegen auf dem natriumhaltigen
Boden die ganze Reihe der Halophyten, wie sie den Salzsteppen
Russlands und Spaniens gemeinsam ist. Einige unter diesen sind
blattlose, ächte Succulenten [Halocnemum, Ar(hrocnemum), wobei es
bemerkenswerth erscheint, dass nur solche Saftpflanzen, bei denen
der Salzgehalt zu der Zurückhaltung des Wassers im Gewebe mitwirkt
das Klima der Wüste ertragen, dass aber, wo diese Funktion
der Oberhaut allein überwiesen ist, die Organisation zu schwach zu
sein scheint, um in der trockenen Sahara-Luft bestehen zu können.
Denn weder die fleischigen Euphorbien noch die Aloeform Sudans
werden innerhalb der Wüstengrenzen erwähnt. Saftige Blätter an
holzigen Axenorganen gehören dagegen zu den häufigsten Erzeugnissen
des Salzbodens der Sahara und die Salsoleen und Zygophylleen
nebst einigen verwandten Gruppen entsprechen durchaus den
Halophyten der Steppe, mit denen sie sogar einzelne Arten gemeinsam
besitzen. Die Reihe dieser Formen wird endlich durch verholzende
i: