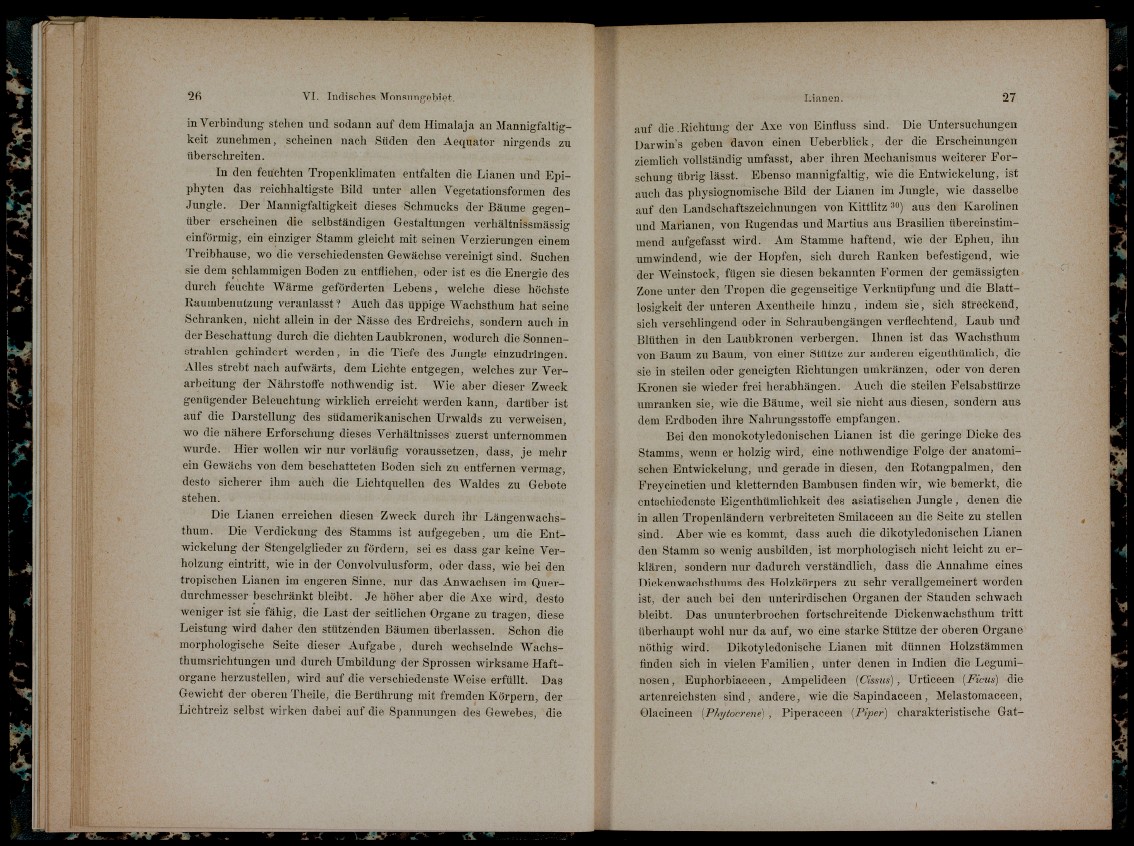
26 VI. Indisches Monsimgebiet. Lianen. 27
in Verbindung stehen und sodann auf dem Himalaja an Mannigfaltigkeit
zunehmen, scheinen nach Süden den Aequator nirgends zu
überschreiten.
In den feuchten Tropenklimaten entfalten die Lianen und Epiphyten
das reichhaltigste Bild unter allen Vegetationsformen des
Jungle. Der Mannigfaltigkeit dieses Schmucks der Bäume gegenüber
erscheinen die selbständigen Gestaltungen verhältnissmässig
einförmig, ein einziger Stamm gleicht mit seinen Verzierungen einem
Treibhause, wo die verschiedensten Gewächse vereinigt sind. Suchen
sie dem schlammigen Boden zu entfliehen, oder ist es die Energie des
durch feuchte V^ärme geförderten Lebens, welche diese höchste
Raumbenutzung veranlasst? Auch das üppige Wachsthum hat seine
Schranken, nicht allein in der Nässe des Erdreichs, sondern auch in
der Beschattung durch die dichten Laubkronen, wodurch die Sonnenstrahlen
gehindert werden, in die Tiefe des Jungle einzudringen.
Alles strebt nach aufwärts, dem Lichte entgegen, welches zur Verarbeitung
der Nährstoffe nothwendig ist. Wie aber dieser Zweck
genügender Beleuchtung wirklich erreicht werden kann, darüber ist
auf die Darstellung des südamerikanischen Urwalds zu verweisen,
wo die nähere Erforschung dieses Verhältnisses zuerst unternommen
wurde. Hier wollen wir nur vorläufig voraussetzen, dass, je mehr
ein Gewächs von dem beschatteten Boden sich zu entfernen vermag,
desto sicherer ihm auch die Lichtquellen des Waldes zu Gebote
stehen.
Die Lianen erreichen diesen Zweck durch ihr Längenwachsthum.
Die Verdickung des Stamms ist aufgegeben, um die Ent-
Wickelung der Stengelglieder zu fördern, sei es dass gar keine Verholzung
eintritt, wie in der Convolvulusform, oder dass, wie bei den
tropischen Lianen im engeren Sinne, nur das Anwachsen im Querdurchmesser
beschränkt bleibt. Je höher aber die Axe wird, desto
weniger ist sie fähig, die Last der seitlichen Organe zu tragen, diese
Leistung wird daher den stützenden Bäumen überlassen. Schon die
morphologische Seite dieser Aufgabe, durch wechselnde Wachsthumsrichtungen
und durch Umbildung der Sprossen wirksame Haftorgane
herzustellen, wird auf die verschiedenste Weise erfüllt. Das
Gewicht der oberen Theile, die Berührung mit fremden Körpern, der
Lichtreiz selbst wirken dabei auf die Spannungen des Gewebes, die
auf die .Richtung der Axe von Einfluss sind. Die Untersuchungen
Darwins geben davon einen Ueberblick, der die Erscheinungen
ziemlich vollständig umfasst, aber ihren Mechanismus weiterer Forschung
übrig lässt. Ebenso mannigfaltig, wie die Entwickelung, ist
auch das physiognomische Bild der Lianen im Jungle, wie dasselbe
auf den Landschaftszeichnungen von Kittlitz ^O) aus den Karolinen
und Marianen, von Rugendas und Martins aus Brasilien übereinstimmend
aufgefasst wird. Am Stamme haftend, wie der Epheu, ihn
umwindend, wie der Hopfen, sich durch Ranken befestigend, wie
der Weinstock, fügen sie diesen bekannten Formen der gemässigten
Zone unter den Tropen die gegenseitige Verknüpfung und die Blattlosigkeit
der unteren Axentheile hinzu, indem sie, sich streckend,
sich verschlingend oder in Schraubengängen verflechtend, Laub und
Blüthen in den Laubkronen verbergen. Ihnen ist das Wachsthum
von Baum zu Baum, von einer Stütze zur anderen eigenthümlich, die
sie in steilen oder geneigten Richtungen umkränzen, oder von deren
Kronen sie wieder frei herabhängen. Auch die steilen Felsabstürze
umranken sie, wie die Bäume, weil sie nicht aus diesen, sondern au&
dem Erdboden ihre Nahrungsstoffe empfangen.
Bei den monokotyledonischen Lianen ist die geringe Dicke des
Stamms, wenn er holzig wird, eine nothwendige Folge der anatomischen
Entwickelung, und gerade in diesen, den Rotangpalmen, den
Freycinetien und kletternden Bambusen finden wir, wie bemerkt, die
entschiedenste Eigenthümlichkeit des asiatischen Jungle, denen die
in allen Tropenländern verbreiteten Smilaceen an die Seite zu stellen
sind. Aber wie es kommt, dass auch die dikotyledonischen Lianen
den Stamm so wenig ausbilden, ist morphologisch nicht leicht zu erklären,
sondern nur dadurch verständlich, dass die Annahme eines
Dickenwachsthums des Holzkörpers zu sehr verallgemeinert worden
ist, der auch bei den unterirdischen Organen der Stauden schwach
bleibt. Das ununterbrochen fortschreitende Dickenwachsthum tritt
überhaupt wohl nur da auf, wo eine starke Stütze der oberen Organe
nöthig wird. Dikotyledonische Lianen mit dünnen Holzstämmen
finden sich in vielen Familien, unter denen in Indien die Leguminosen,
Euphorbiaceen, Ampelideen [Cisstcs), Urticeen {Ficus) die
artenreichsten sind, andere, wie die Sapindaceen, Melastomaceen,
Olacineen [Phytocrene), Piperaceen [Piper) charakteristische Gat-
%