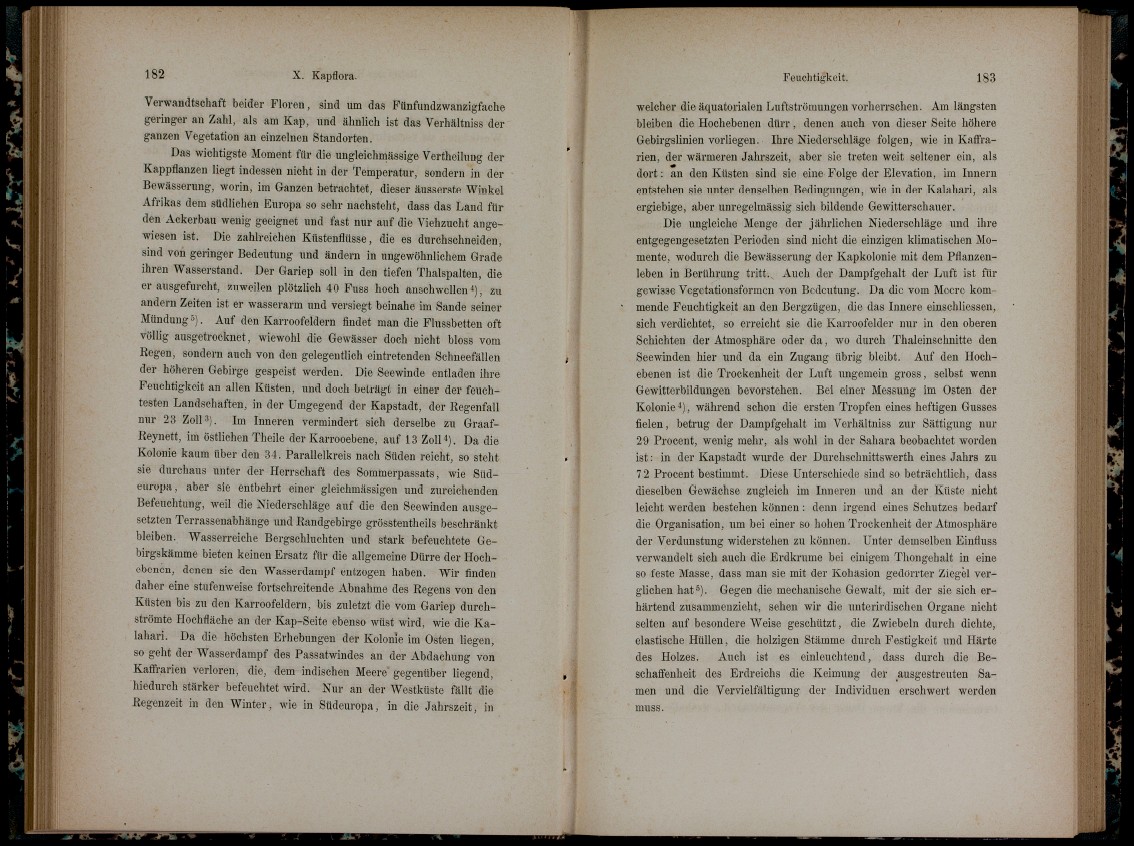
'-r Ii:
182 X. Kapflora. Feuchtigkeit. 183
Verwandtschaft beider Floren, sind um das Fünfundzwanzigfache
geringer an Zahl, als am Kap, und ähnlich ist das Verhältniss der
ganzen Vegetation an einzelnen Standorten.
Das wichtigste Moment für die ungleichmässige Vertheilung der
Kappflanzen liegt indessen nicht in der Temperatur, sondern in der
Bewässerung, worin, im Ganzen betrachtet, dieser äusserste Winkel
Afrikas dem südlichen Europa so sehr nachsteht, dass das Land für
den Ackerbau wenig geeignet und fast nur auf die Viehzucht angewiesen
ist. Die zahlreichen Küstenflüsse, die es durchschneiden,
sind von geringer Bedeutung und ändern in ungewöhnlichem Grade
ihren Wasserstand. Der Gariep soll in den tiefen Thalspalten, die
er ausgefurcht, zuweilen plötzlich 40 Fuss hoch anschwellen, zu
andern Zeiten ist er wasserarm und versiegt beinahe im Sande seiner
Mündung 5). Auf den Karroofeldern findet man die Flussbetten oft
völlig ausgetrocknet, wiewohl die Gewässer doch nicht bloss vom
Regen, sondern auch von den gelegentlich eintretenden Schneefällen
der höheren Gebirge gespeist werden. Die Seewinde entladen ihre
Feuchtigkeit an allen Küsten, und doch beträgt in einer der feuchtesten
Landschaften, in der Umgegend der Kapstadt, der Regenfall
nur 23 Zoll 3). Im Inneren vermindert sich derselbe zu Graaf-
Reynett, im östlichen Theile der Karrooebene, auf 13 Zoll 4). Da die
Kolonie kaum über den 34. Parallelkreis nach Süden reicht, so steht
sie durchaus unter der Herrschaft des Sommerpassats, wie Südeuropa,
aber sie entbehrt einer gleichmässigen und zureichenden
Befeuchtung, weil die Niederschläge auf die den Seewinden ausgesetzten
Terrassenabhänge und Randgebirge grösstentheils beschränkt
bleiben. Wasserreiche Bergschluchten und stark befeuchtete Gebirgskämme
bieten keinen Ersatz für die allgemeine Dürre der Hochebenen,
denen sie den Wasserdampf entzogen haben. Wir finden
daher eine stufenweise fortschreitende Abnahme des Regens von den
Küsten bis zu den Karroofeldern, bis zuletzt die vom Gariep durchströmte
Plochfläche an der Kap-Seite ebenso wüst wird, wie die Kalahari.
Da die höchsten Erhebungen der Kolonie im Osten liegen,
so geht der Wasserdampf des Passatwindes an der Abdachung von
Kafirarien verloren, die, dem indischen Meere' gegenüber liegend,
hiedurch stärker befeuchtet wird. Nur an der Westküste fällt die
Regenzeit in den Winter, wie in Südeuropa, in die Jahrszeit, in
welcher die äquatorialen Luftströmungen vorherrschen. Am längsten
bleiben die Hochebenen dürr, denen auch von dieser Seite höhere
Gebirgslinien vorliegen. Ihre Niederschläge folgen, wie in KaiFrarien,
der wärmeren Jahrszeit, aber sie treten weit seltener ein, als
dort: an den Küsten sind sie eine Folge der Elevation, im Innern
entstehen sie iinter denselben Bedingungen, wie in der Kalahari, als
ergiebige, aber unregelmässig sich bildende Gewitterschauer.
Die ungleiche Menge der jährlichen Niederschläge und ihre
entgegengesetzten Perioden sind nicht die einzigen klimatischen Momente,
wodurch die Bewässerung der Kapkolonie mit dem Pflanzenleben
in Berührung tritt.. Auch der Dampfgehalt der Luft ist für
gewisse Vegetationsformen von Bedeutung. Da die vom Meere kommende
Feuchtigkeit an den Bergzügen, die das Innere einschliessen,
sich verdichtet, so erreicht sie die Karroofelder nur in den oberen
Schichten der Atmosphäre oder da, wo durch Thaleinschnitte den
Seewinden hier nnd da ein Zugang übrig bleibt. Auf den Hochebenen
ist die Trockenheit der Luft ungemein gross ^ selbst wenn
Gewitterbildungen bevorstehen. Bei einer Messung im Osten der
Kolonie^), während schon die ersten Tropfen eines heftigen Gusses
fielen, betrug der Dampfgehalt im Verhältniss zur Sättigung nur
29 Procent, wenig mehr, als wohl in der Sahara beobachtet worden
ist: in der Kapstadt wurde der Durchschnittswerth eines Jahrs zu
72 Procent bestimmt. Diese Unterschiede sind so beträchtlich, dass
dieselben Gewächse zugleich im Inneren und an der Küste nicht
leicht werden bestehen können: denn irgend eines Schutzes bedarf
die Organisation, um bei einer so hohen Trockenheit der Atmosphäre
der Verdunstung widerstehen zu können. Unter demselben Einfluss
verwandelt sich auch die Erdkrume bei einigem Thongehalt in eine
so feste Masse, dass man sie mit der Kohäsion gedörrter Ziegd verglichen
hat^). Gegen die mechanische Gewalt, mit der sie sich erhärtend
zusammenzieht, sehen wir die unterirdischen Organe nicht
selten auf besondere Weise geschützt, die Zwiebeln durch dichte,
elastische Hüllen, die holzigen Stämme durch Festigkeit und Härte
des Holzes. Auch ist es einleuchtend, dass durch die Beschaffenheit
des Erdreichs die Keimung der ausgestreuten Samen
und die Vervielfältigung der Individuen erschwert werden
muss.
iiifs • • • ,
'"i
-
•i
i j : ,
L J^m^