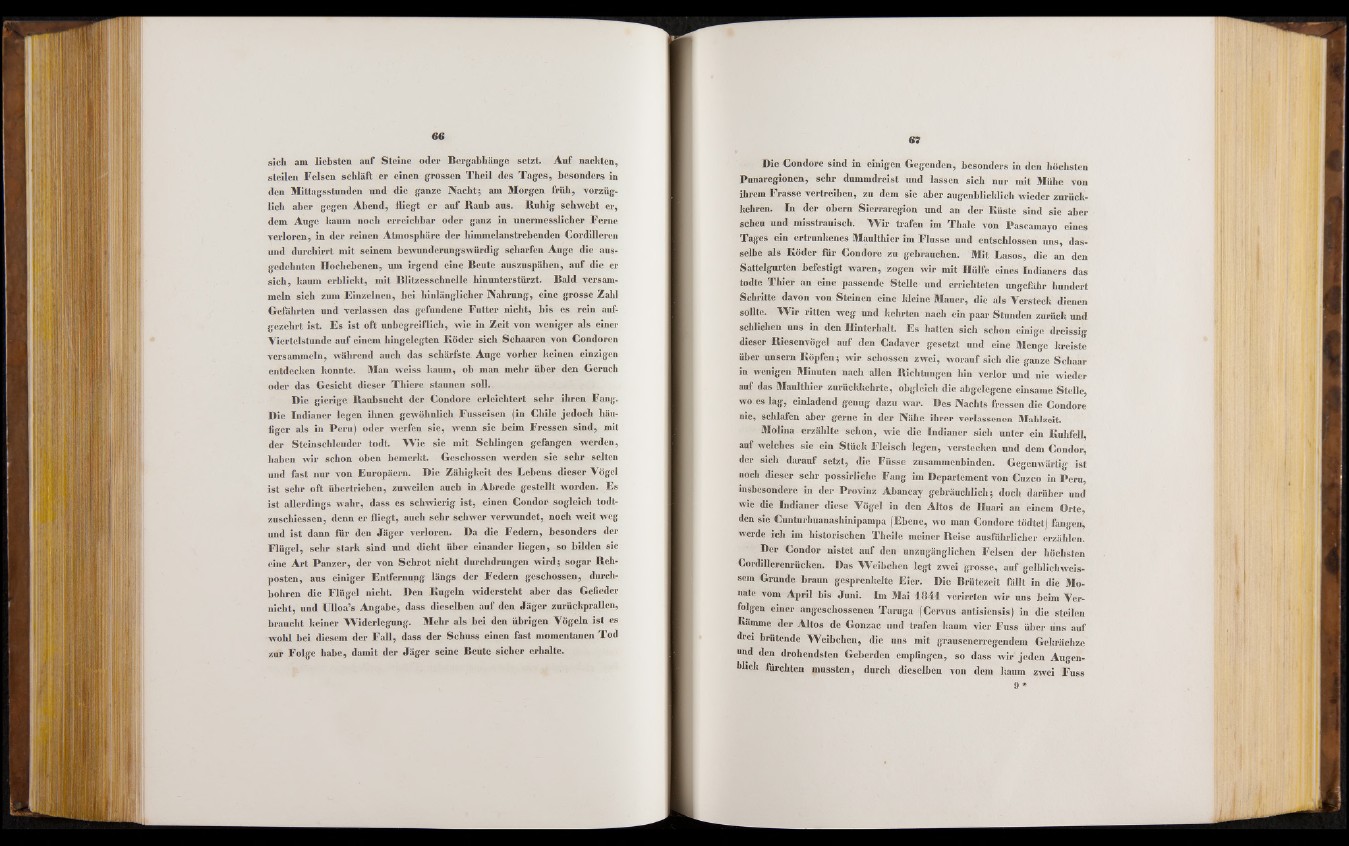
sich am liebsten auf Steine oder Bergabhänge setzt. Auf nackten,
steilen Felsen schläft er einen grossen Theil des Tages, besonders in
den Mittagsstunden und die ganze Nacht; am Morgen früh, vorzüglich
aber gegen Abend, fliegt er auf Rauh aus. Ruhig schwebt er,
dem Auge kaum noch erreichbar oder ganz in unermesslicher Ferne
verloren, in der reinen Atmosphäre der himmelanstrebenden Cordilleren
und durchirrt mit seinem bewunderungswürdig scharfen Auge die ausgedehnten
Hochebenen, um irgend eine Beute auszuspähen, auf die er
sich, kaum erblickt, mit Blitzesschnelle hinunterstürzt. Bald versammeln
sich zum Einzelnen, bei hinlänglicher Nahrung, eine grosse Zahl
Gefährten und verlassen das gefundene Futter nicht, bis es rein anf-
gezehrt ist. Es ist oft unbegreiflich, wie in Zeit von weniger als einer
Viertelstunde auf einem hingelegten Köder sich Schaaren von Condoren
versammeln, während auch das schärfste. Auge vorher keinen einzigen
entdecken konnte. Man weiss kaum, ob man mehr über den Geruch
oder das Gesicht dieser Thiere staunen soll.
Die gierige Raubsucht der Condore erleichtert sehr ihren Fang.
Die Indianer legen ihnen gewöhnlich Fusseisen (in Chile jedoch häufiger
als in Peru) oder werfen sie, wenn sie beim Fressen sind, mit
der Steinschleuder todt. Wie sie mit Schlingen gefangen werden,
haben wir schon oben bemerkt. Geschossen werden sie sehr selten
und fast nur von Europäern. Die Zähigkeit des Lebens dieser Vögel
ist sehr oft übertrieben, zuweilen auch in Abrede gestellt worden. Es
ist allerdings wahr, dass es schwierig ist, einen Condor sogleich todt-
zuschiessen, denn er fliegt, auch sehr schwer verwundet, noch weit weg
und ist dann für den Jäger verloren. Da die Federn, besonders der
Flügel, sehr stark sind und dicht über einander liegen, so bilden sie
eine Art Panzer, der von Schrot nicht durchdrungen wird; sogar Rehposten,
aus einiger Entfernung längs der Federn geschossen, durchbohren
die Flügel nicht. Den Kngeln widersteht aber das Gefieder
nicht, und Ulloa’s Angabe, dass dieselben auf den Jäger zurückprallen,
braucht keiner Widerlegung. Mehr als bei den übrigen Vögeln ist es
wohl bei diesem der Fall, dass der Schuss einen fast momentanen Tod
zur Folge habe, damit der Jäger seine Beute sicher erhalte.
Die Condore sind in einigen Gegenden, besonders in den höchsten
Punaregionen, sehr dummdreist und lassen sich nur mit Mühe von
ihrem Frasse vertreiben, zu dem sie aber augenblicklich wieder zurückkehren.
In der obern Sierrarcgion und an der Küste sind sie aber
scheu und misstrauisch. W ir trafen im Thale von Pascamayo eines
Tages ein ertrunkenes Maulthier im Flusse und entschlossen uns, dasselbe
als Köder für Condore zu gebrauchen. Mit Lasos, die an den
Sattelgurten befestigt waren, zogen wir mit Hülfe eines Indianers das
todte Thier an eine passende Stelle und errichteten ungefähr hundert
Schritte davon von Steinen eine kleine Mauer, die als Versteck dienen
sollte. W ir ritten weg und kehrten nach ein paar Stunden zurück und
schlichen uns in den Hinterhalt. Es hatten sich schon einige dreissig
dieser Ricsenvögel auf den Cadaver gesetzt und eine Menge kreiste
über unsern Köpfen; wir schossen zwei, worauf sich die ganze Schaar
in wenigen Minuten nach allen Richtungen hin verlor und nie wieder
auf das Maulthier zurückkehrte, obgleich die abgelegene einsame Stelle,
wo es lag, einladend genug dazu war. Des Nachts fressen die Condore
nie, schlafen aber gerne in der Nähe ihrer verlassenen Mahlzeit.
Molina erzählte schon, wie die Indianer sich unter ein Kuhfell,
auf welches sie ein Stück Fleisch legen, verstecken und dem Condor,
der sich darauf setzt, die Füsse znsammenbinden. Gegenwärtig ist
noch dieser sehr possirliche Fang im Departement von Cuzco in Peru,
insbesondere in der Provinz Abancav gebräuchlich; doch darüber und
wie die Indianer diese Vögel in den Altos de Huari an einem Orte,
den sie Cunturhuanashinipampa (Ebene, wo man Condore tödtet) fangen,
werde ich im historischen Theile meiner Reise ausführlicher erzählen.
Der Condor nistet auf den unzugänglichen Felsen der höchsten
Cordillerenrücken. Das Weibchen legt zwei grosse, auf gelblichweis-
sem Grunde braun gesprenkelte Eier. Die Brütezeit fällt in die Monate
vom April bis Juni. Im Mai 1841 verirrten wir uns beim Verfolgen
einer angeschossenen Tarnga (Cervus antisiensis) in die steilen
Kämme der Altos de Gonzac und trafen kaum vier Fuss über uns auf
drei brütende Weibchen, die uns mit grausenerregendem Gekrächze
und den drohendsten Geberden empfingen, so dass wir jeden Augenblick
furchten mussten, durch dieselben von dem kaum zwei Fuss
9 *