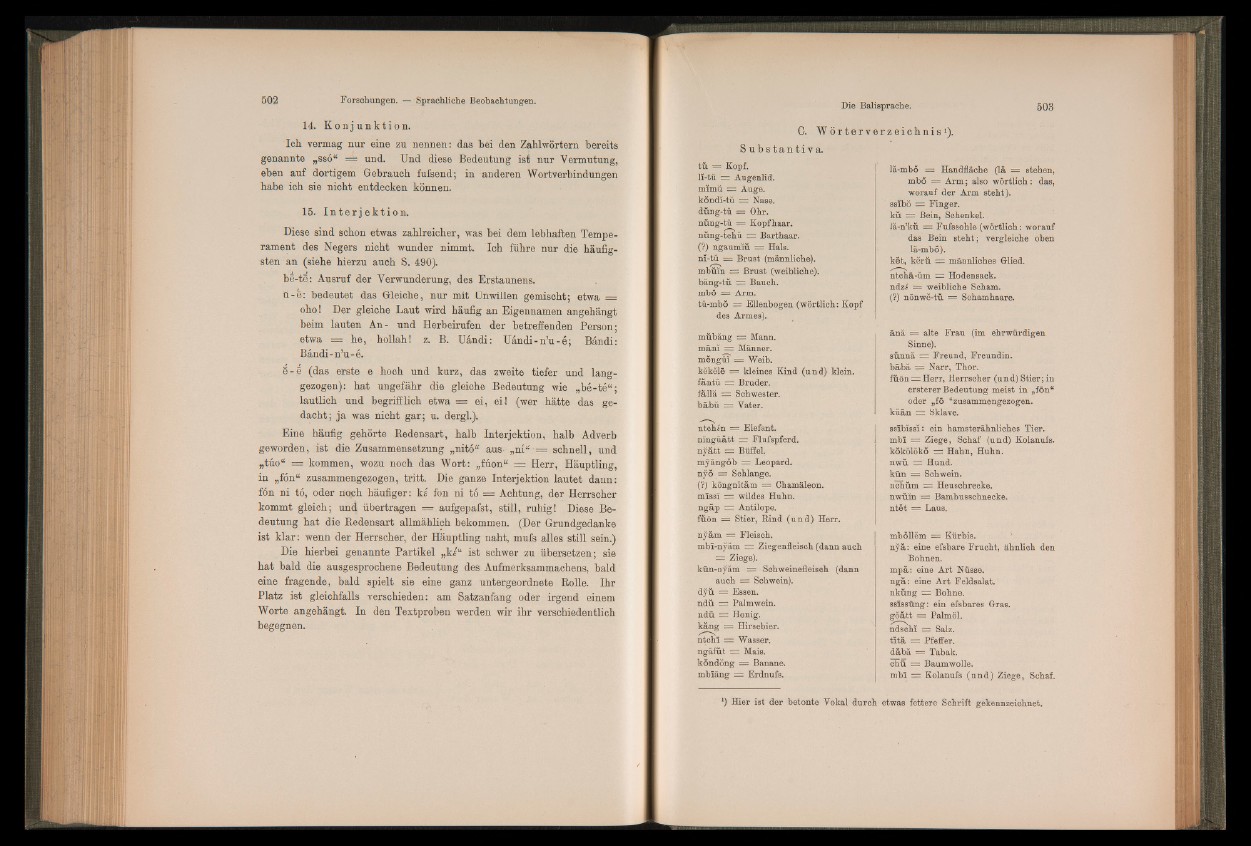
14. K o n j u n k t i o n .
Ich vermag nur eine zu nennen: das hei den Zahlwörtern bereits
genannte „sso“ = und. Und diese Bedeutung ist n u r Vermutung,
eben auf dortigem Gebrauch fufsend; in anderen Wortverbindungen
habe ich sie nicht entdecken können.
15. I n t e r j e k t i o n .
Diese sind schon etwas zahlreicher, was bei dem lebhaften Temperament
des Negers nicht wunder nimmt. Ich führe nur die häufigsten
an (siehe hierzu auch S. 490).
be-te: Ausruf der Verwunderung, des Erstaunens.
ü - e : bedeutet das Gleiche, nur mit Unwillen gemischt; etwa =
oho! Der gleiche Lau t wird häufig an Eigennamen angehängt
beim lauten An- und Herbeirufen der betreffenden Person;
etwa = he, hollah! z. B. Uändi: U än d i-n ’u - e ; Bändi:
Bändi-n’u -e .
ö - e (das erste e hoch und kurz, das zweite tiefer und langgezogen):
h a t ungefähr die gleiche Bedeutung wie „b e -te “ ;
lautlich und begrifflich etwa = ei, eil (wer hätte das gedacht;
ja was nicht gar; u. dergl.).
Eine häufig gehörte Redensart, halb Interjektion, halb Adverb
geworden, ist die Zusammensetzung „nitö“ aus „ni“ — schnell, und
„tüo“ — kommen, wozu noch das Wort: „fuon“ = Herr, Häuptling,
in „fön“ zusammengezogen, tritt. Die ganze Interjektion lau te t dann:
fön ni tö, oder noch häufiger: k t fon ni tö = Achtung, der Herrscher
kommt gleich; und übertragen — aufgepafst, still, ruhig! Diese Bedeutung
h a t die Redensart allmählich bekommen. (Der Grundgedanke
ist k la r: wenn der Herrscher, der Häuptling naht, mufs alles still sein.)
Die hierbei genannte Partikel „ k t“ ist schwer zu übersetzen; sie
h a t bald die ausgesprochene Bedeutung des Aufmerksammachens, bald
eine fragende, bald spielt sie eine ganz untergeordnete Rolle. Ihr
Platz ist gleichfalls verschieden: am Satzanfang oder irgend einem
Worte angehängt. In den Textproben werden wir ih r verschiedentlich
begegnen.
C. W ö r t e r v e r z e i c h n i s 1).
S u b s t a n t i v a.
tu = Kopf,
li-tü = Augenlid,
mimü = Auge,
köndi-tü = Nase,
dun g-tu = Ohr.
nüng-tü = Kopfhaar,
nüng-tchü = Barthaar.
(?) ngaumiü = Hals,
ni-tü = Brust (männliche),
mbüin = Brust (weibliche),
bäng-tu == Bauch,
mbö ,= Arm.
tü-mbö = Ellenbogen (wörtlich: Kopf
des Armes).
mübäng = Mann,
mäni = Männer,
mengüi = Weib.
kekele = kleines Kind (u n d ) klein,
fän tü = Bruder,
fällä = Schwester,
bäb ü = Yater.
ntchin = Elefant,
nmgüätt = Flufspferd.
n y ä tt = Büffel,
myängöb = Leopard,
nyö = Schlange.
(?) köngnitäm = Chamäleon.
missi = wildes Huhn.
ngäp = Antilope.
fuön = Stier, Rind (u n d ) Herr.
nyäm = Fleisch.
mbi-nyäm = Ziegenfleisch (dann auch
'•'== Ziege),
kün-nyäm = Schweinefleisch (dann
auch = Schwein).
d y ü jS : Essen,
n d ü = Palmwein,
n d ü ;^ : Honig,
käng .== Hirsebier,
ntch i = Wasser,
ngäfüt = Mais,
köndöng = Banane,
mbiäng slJErdnufs.
lä-mbö = Handfläche (lä = stehen,
mbö = Arm; also wörtlich: das,
worauf der Arm steht),
ssibö = Finger,
k ü = Bein, Schenkel,
lä-n’k u = Fufssohle (wörtlich: worauf
das Bein steht; vergleiche oben
lä-mbö).
ket, k e rü = männliches Glied,
ntchä-üm = Hodensack,
ndz« = weibliche Scham.
(?) nönwe-tü = Schamhaare.
änä = alte Frau (im ehrwürdigen
Sinne).
sünnä = Freund, Freundin,
bäbä = Narr, Thor,
fuön = Herr, Herrscher (und) Stier; in
ersterer Bedeutung meist in „fön“
oder „fö “zusammengezogen,
küän = Sklave.
s8lbissi: ein hamsterähnliches Tier.
mbl = Ziege, Schaf (und) Kolanuis.
kökölökö = Hahn, Huhn.
nwü = Hund.
kün = Schwein.
nchüm = Heuschrecke.
nwuin = Bambusschnecke.
n te t = Laus.
mböllem = Kürbis,
nyä: eine efsbare Frucht, ähnlich den
Bohnen,
mpä: eine Art Nüsse,
n g ä : eine Art Feldsalat,
nküng = Bohne,
sslssüng: ein efsbares Gras,
g ö ä tt = Palmöl,
ndschi = Salz,
t i t ä = Pfeffer,
däbä = Tabak,
ch ü pä: Baumwolle,
mbi = Kolanufs (u n d ) Ziege, Schaf.
x) Hier ist der betonte Vokal durch etwas fettere Schrift gekennzeichnet.