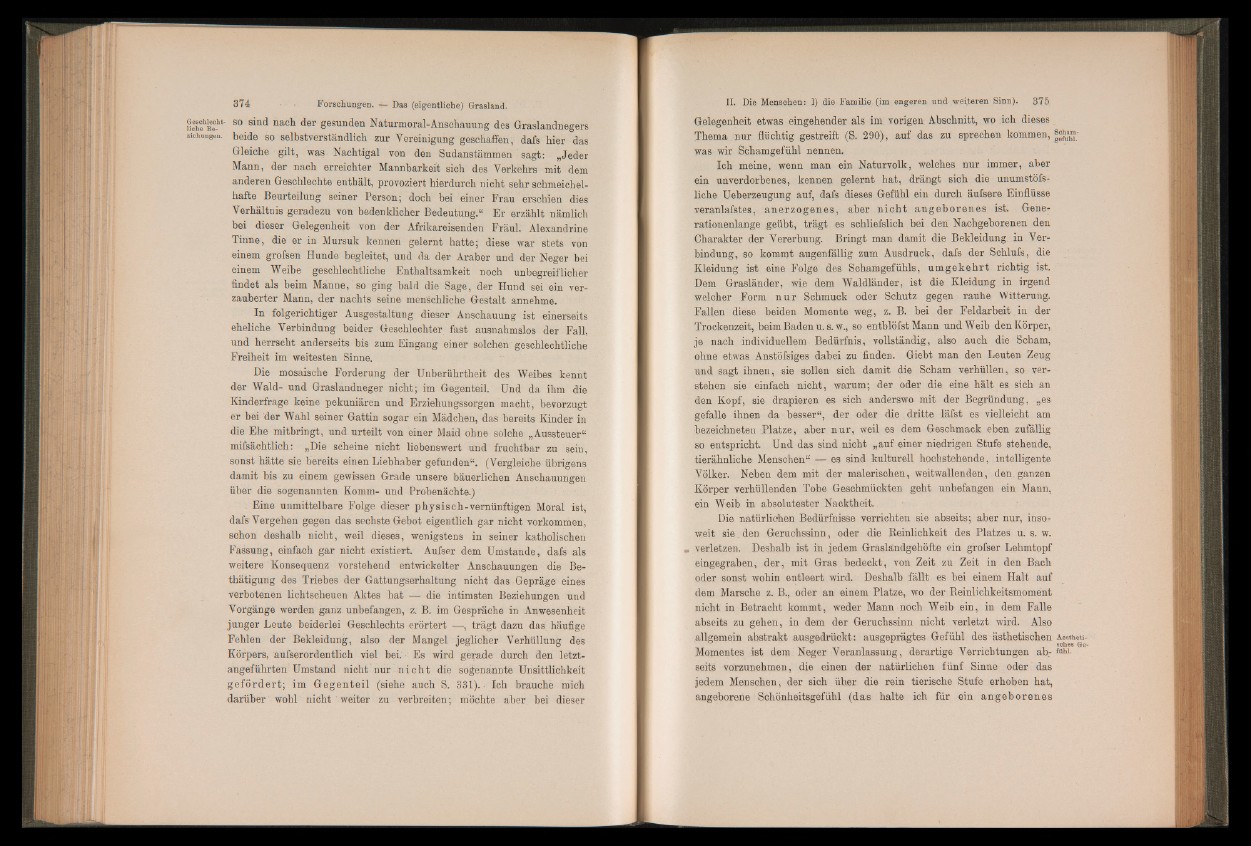
Geschlechtlich
e Beziehungen.
so sind nach der gesunden Naturmoral-Anschauung des Graslandnegers
beide so selbstverständlich zur Vereinigung geschaffen, dafs hier das
Gleiche gilt, was Nachtigal von den Sudanstämmen sagt: „Jeder
Mann, der nach erreichter Mannbarkeit sich des Verkehrs mit dem
anderen Geschlechte enthält, provoziert hierdurch nicht sehr schmeichelhafte
Beurteilung seiner Person; doch bei einer Frau erschien dies
Verhältnis geradezu von bedenklicher Bedeutung.“ E r erzählt nämlich
bei dieser Gelegenheit von der Afrikareisenden Fräul. Alexandrine
Tinne, die er in Mursuk kennen gelernt h a tte ; diese war stets von
einem grofsen Hunde begleitet, und da der Araber und der Neger bei
einem Weibe geschlechtliche Enthaltsamkeit noch unbegreiflicher
findet als beim Manne, so ging bald die Sage, der Hund sei ein verzauberter
Mann, der nachts seine menschliche Gestalt annehme.
In folgerichtiger Ausgestaltung dieser Anschauung ist einerseits
eheliche Verbindung beider Geschlechter fast ausnahmslos der Fall,
und herrscht anderseits bis zum Eingang einer solchen geschlechtliche
Freiheit im weitesten Sinne.
Die mosaische Forderung der Unberührtheit des Weibes kennt
der Wald- und Graslandneger nicht; im Gegenteil. Und da ihm die
Kinderfrage keine pekuniären und Erziehungssorgen macht, bevorzugt
er bei der Wahl seiner Gattin sogar ein Mädchen, das bereits Kinder in
die Ehe mitbringt, und u rteilt von einer Maid ohne solche „Aussteuer“
mifsächtlich: „Die scheine nicht liebenswert und fruchtbar zu sein,
sonst hätte sie bereits einen Liebhaber gefunden“. (Vergleiche übrigens
damit bis zu einem gewissen Grade unsere bäuerlichen Anschauungen
über die sogenannten Komm- und Probenächte.)
Eine unmittelbare Folge dieser physisch -v ern ü n ftig en Moral ist,
dafs Vergehen gegen das sechste Gebot eigentlich gar nicht Vorkommen,
schon deshalb nicht, weil dieses, wenigstens in seiner katholischen
Fassung, einfach gar nicht existiert. Aufser dem Umstande, dafs als
weitere Konsequenz vorstehend entwickelter Anschauungen die Be-
thätigung des Triebes der Gattungserhaltung nicht das Gepräge eines
verbotenen lichtscheuen Aktes h a t i-üi)die intimsten Beziehungen und
Vorgänge werden ganz unbefangen, z. B. im Gespräche in Anwesenheit
junger Leute beiderlei Geschlechts erörtert —, trä g t dazu das. häufige
Fehlen der Bekleidung, also der Mangel jeglicher Verhüllung des
Körpers, aufserordentlich viel bei. • Es wird gerade durch den letztangeführten
Umstand nicht nur n i c h t die sogenannte Unsittlichkeit
g e f ö r d e r t; im G e g e n te il (siehe auch S. 331). ■ Ich brauche mich
darüber wohl nicht weiter zu verbreiten; möchte aber bei dieser
Gelegenheit etwas eingehender als im vorigen Abschnitt, wo ich dieses
Thema nur flüchtig gestreift (S. 290), auf das zU sprechen kommen,
was wir Schamgefühl nennen.
Ich meine, wenn man ein Naturvolk, welches nur immer, aber
ein unverdorbenes, kennen gelernt ha t, drängt sich die unumstöfs-
liche Ueberzeugung auf, dafs dieses Gefühl ein durch äufsere Einflüsse
veranlafstes, a n e r z o g e n e s , aber n i c h t a n g e b o r e n e s ist. Generationenlange
geübt, trä g t es schliefslich bei den Nachgeborenen den
Charakter der Vererbung. Bringt man damit die Bekleidung, in Verbindung,
so kommt augenfällig zum Ausdruck, dafs der Schlufs, die
Kleidung ist eine Folge des Schamgefühls, um g e k e h r t richtig ist.
Dem Grasländer, wie dem Waldländer, is t die Kleidung in irgend
welcher Form n u r Schmuck oder Schutz gegen rauhe Witterung.
Fallen diese beiden Momente weg, z. B. bei der Feldarbeit in der
Trockenzeit, beim Baden u. s. w., so entblöfst Mann und Weib den Körper,
je nach individuellem Bedürfnis, vollständig, also auch die Scham,
ohne etwas Anstöfsiges dabei zu finden. Giebt man den Leuten Zeug
und sagt ihnen, sie sollen sich damit die Scham verhüllen, so verstehen
sie einfach nicht, warum; der oder die eine h ä lt es sich an
den Kopf, sie drapieren es sich anderswo mit der Begründung, „es
gefalle ihnen da besser“, der oder die dritte läfst es vielleicht am
bezeichneten :Platze, aber n u r , weil es dem Geschmack eben zufällig
so entspricht. Und das sind nicht „auf einer niedrigen Stufe stehende,
tierähnliche Menschen“ — es sind kulturell hochstehende, intelligente
Völker. Neben dem mit der malerischen, weitwallenden, den.ganzen
Körper verhüllenden Tobe Geschmückten geht unbefangen ein Mann,
ein Weib in absolutester Nacktheit.
Die natürlichen Bedürfnisse verrichten sie abseits; aber nur, insoweit
s ie . den Geruchssinn, oder die Reinlichkeit des Platzes u. s. w.
verletzen. Deshalb ist in jedem Grasländgehöfte ein grofser Lehmtopf
eingegraben, der, mit Gras bedeckt, von Zeit zu Zeit in den Bach
oder sonst wohin entleert wird. Deshalb fä llt es bei einem Halt auf
dem Marsche z. B., oder an einem Platze, wo der Reinlichkeitsmoment
nicht in Betracht kommt, weder Mann noch Weib ein, in dem Falle
abseits zu gehen, in dem der Geruchssinn nicht verletzt wird. Also
allgemein abstrakt ausgedrückt: ausgeprägtes Gefühl des ästhetischen Aestheu-
Momentes ist dem Neger Veranlassung, derartige Verrichtungen ab- ftUlL
seits vorzunehmen, die einen der natürlichen fünf Sinne oder das
jedem Menschen, der sich über die rein tierische Stufe erhoben hat,
angeborene Schönheitsgefühl (d a s halte ich für ein a n g e b o r e n e s