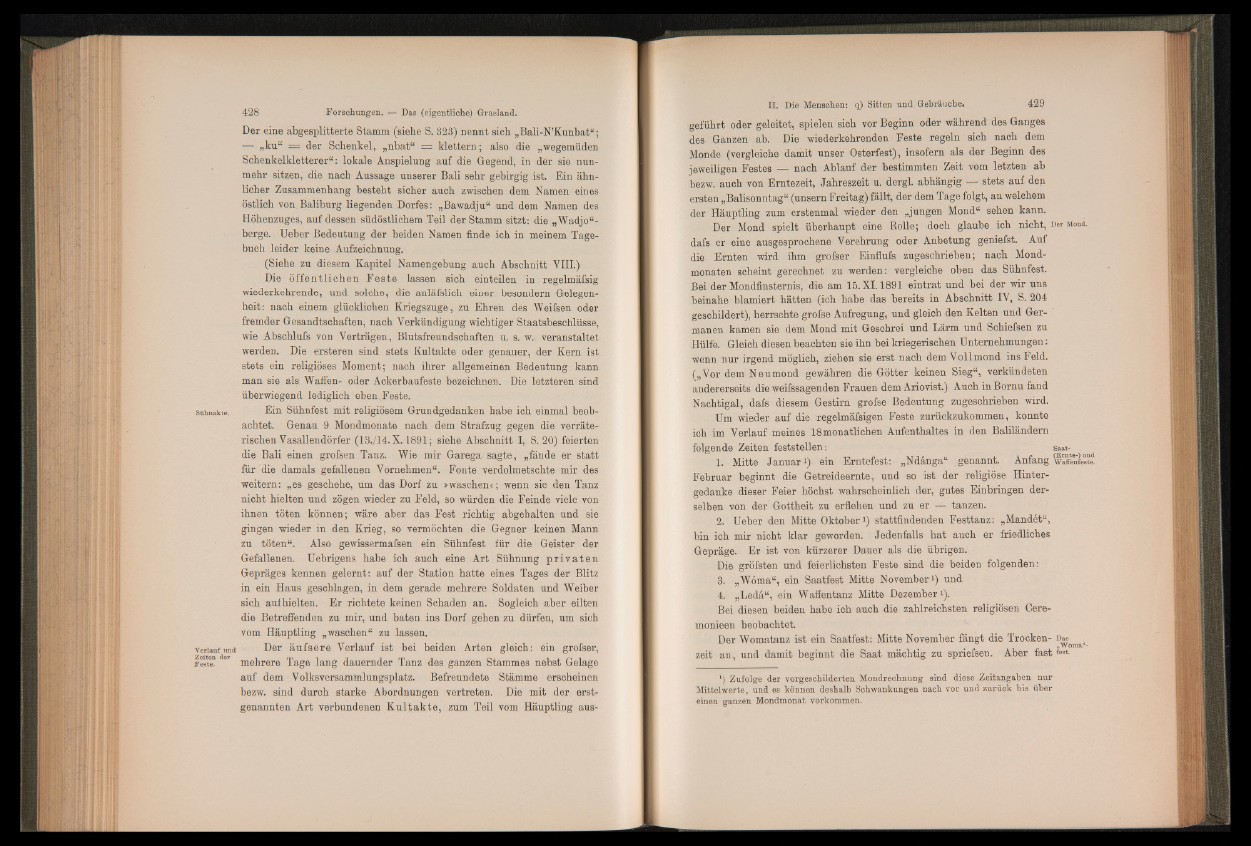
Der eine abgesplitterte Stamm (siehe S. 323) nennt sich „Bali-N’Kunbat“ ;
— „ku“ = der Schenkel, „nbat“ = klettern; also die „wegemüden
Schenkelkletterer“ : lokale Anspielung auf die Gegend, in der sie nunmehr
sitzen, die nach Aussage unserer Bali sehr gebirgig ist. Ein ähnlicher
Zusammenhang besteht sicher auch zwischen dem Namen eines
östlich von Baliburg liegenden Dorfes: „Bawadju“ und dem Namen des
Höhenzuges, auf dessen südöstlichem Teil der Stamm sitzt: die „Wadjo“-
berge. Ueber Bedeutung der beiden Namen finde ich in meinem Tagebuch
leider keine Aufzeichnung.
(Siehe zu diesem Kapitel Namengebung auch Abschnitt VIII.)
Die ö f f e n tlic h e n F e s t e lassen sich einteilen in regelmäfsig
wiederkehrende, und solche, die anläfslich einer besondern Gelegenheit:
nach einem glücklichen Kriegszuge, zu Ehren des Weifsen oder
fremder Gesandtschaften, nach Verkündigung wichtiger Staatsbeschlüsse,
wie Abschlufs von Verträgen, Blutsfreundschaften u. s. w. veranstaltet
werden. Die ersteren sind stets Kultakte oder genauer, der Kern ist
stets ein religiöses Moment; nach ihrer allgemeinen Bedeutung kann
man sie als Waffen- oder Ackerbaufeste bezeichnen. Die letzteren sind
überwiegend lediglich eben,Feste.
sühn»kte. Ein Sühnfest mit religiösem Grundgedanken habe ich einmal beobachtet.
Genau 9 Mondmonate nach dem Strafzug gegen die verräterischen
Vasallendörfer (13./14.X. 1891; siehe Abschnitt I, S. 20) feierten
die Bali einen grofsen Tanz. Wie mir Garega sagte, „fände er sta tt
für die damals gefallenen Vornehmen“. Fonte verdolmetschte mir des
weitern: „es geschehe, um das Dorf zu »waschen«; wenn sie den Tanz
nicht hielten und zögen wieder zu Feld, so würden die Feinde viele von
ihnen töten können; wäre aber das Fest richtig abgehalten und sie
gingen wieder in den Krieg, so vermöchten die Gegner keinen Mann
zu tö ten “. Also gewissermafsen ein Sühnfest für die Geister der
Gefallenen. Uebrigens habe ich auch eine Art Sühnung p r i v a t e n
Gepräges kennen gelernt: auf der Station hatte eines Tages der Blitz
in ein Haus geschlagen, in dem gerade mehrere Soldaten und Weiher
sich auf hielten. E r richtete keinen Schaden an. Sogleich aber eilten
die Betreffenden zu mir, und baten ins Dorf gehen zu dürfen, um sich
vom Häuptling „waschen“ zu lassen,
verlauf und Der ä u f s e r e Verlauf ist bei beiden Arten gleich: ein grofser,
Feste! der mehrere Tage lang dauernder Tanz des ganzen Stammes nebst Gelage
auf dem Volksversammlungsplatz. Befreundete Stämme erscheinen
bezw. sind durch starke Abordnungen vertreten. Die mit der erstgenannten
Art verbundenen K u lta k t e , zum Teil vom Häuptling ausgeführt
oder geleitet, spielen sich vor Beginn oder während des Ganges
des Ganzen ab. Die wiederkehrenden Feste regeln sich nach dem
Monde (vergleiche damit unser Osterfest), insofern als der Beginn des
jeweiligen Festes — nach Ablauf der bestimmten Zeit vom letzten ab
bezw. auch von Erntezeit, Jahreszeit u. dergl. abhängig — stets auf den
ersten „Balisonntag“ (unsern Freitag) fällt, der dem Tage folgt, an welchem
der Häuptling zum erstenmal wieder den „jungen Mond“ sehen kann.
Der Mond spielt überhaupt eine Rolle; doch glaube ich nicht, Der Mona,
dafs er eine ausgesprochene Verehrung oder Anbetung geniefst. Auf
die Ernten wird ihm grofser Einflufs zugeschrieben; nach Mondmonaten
scheint gerechnet zu werden: vergleiche oben das Sühnfest.
Bei der Mondfinsternis, die am 15. XI. 1891 ein tra t und bei der wir uns
beinahe blamiert hätten (ich habe das bereits in Abschnitt IV, S. 204
geschildert), herrschte grofse Aufregung, und gleich den Kelten und Germanen
kamen sie dem Mond mit Geschrei und Lärm und Schiefsen zu
Hülfe. Gleich diesen beachten sie ihn bei kriegerischen Unternehmungen:
wenn nur irgend möglich, ziehen sie erst nach dem Vollmond ins Feld.
(„Vor dem Neumond gewähren die Götter keinen Sieg“, verkündeten
andererseits die weifssagenden Frauen dem Ariovist.) Auch in Bornu fand
Nachtigal, dafs diesem Gestirn grofse Bedeutung zugeschrieben wird.
Um wieder auf die regelmäfsigen Feste zurückzukommen, konnte
ich im Verlauf meines 18monatlichen Aufenthaltes in den Baliländern
folgende Zeiten feststellen: saat-
1. Mitte J a n u a r1) ein Erntefest: „Ndänga“ genannt. Anfang wSä"fe“t8.
Februar beginnt die Getreideernte, und so ist der religiöse Hintergedanke
dieser Feier höchst wahrscheinlich der, gutes Einbringen derselben
von der Gottheit zu erflehen und zu er — tanzen.
2. Ueber den Mitte Oktober1) stattfindenden Festtanz: „Mandet“,
bin ich mir nicht klar geworden. Jedenfalls h a t auch er friedliches
Gepräge. Er ist von kürzerer Dauer als die übrigen.
Die gröfsten und feierlichsten Feste sind die beiden folgenden:
3. „Woma“, ein Saatfest Mitte November1) und
4. „Ledä“, ein Waffentanz Mitte Dezember1).
Bei diesen beiden habe ich auch die zahlreichsten religiösen Cere-
monieen beobachtet.
Der Womatanz ist ein Saatfest: Mitte November fängt die Trocken- dm
„Woma“-
zeit an, und damit beginnt die Saat mächtig zu spriefsen. Aber f a s t featl)
Zufolge der vorgeschilderten Mondrechnung sind diese Zeitangaben nur
Mittelwerte, und es können deshalb Schwankungen nach vor und zurück bis über
einen ganzen Mondmonat Vorkommen.