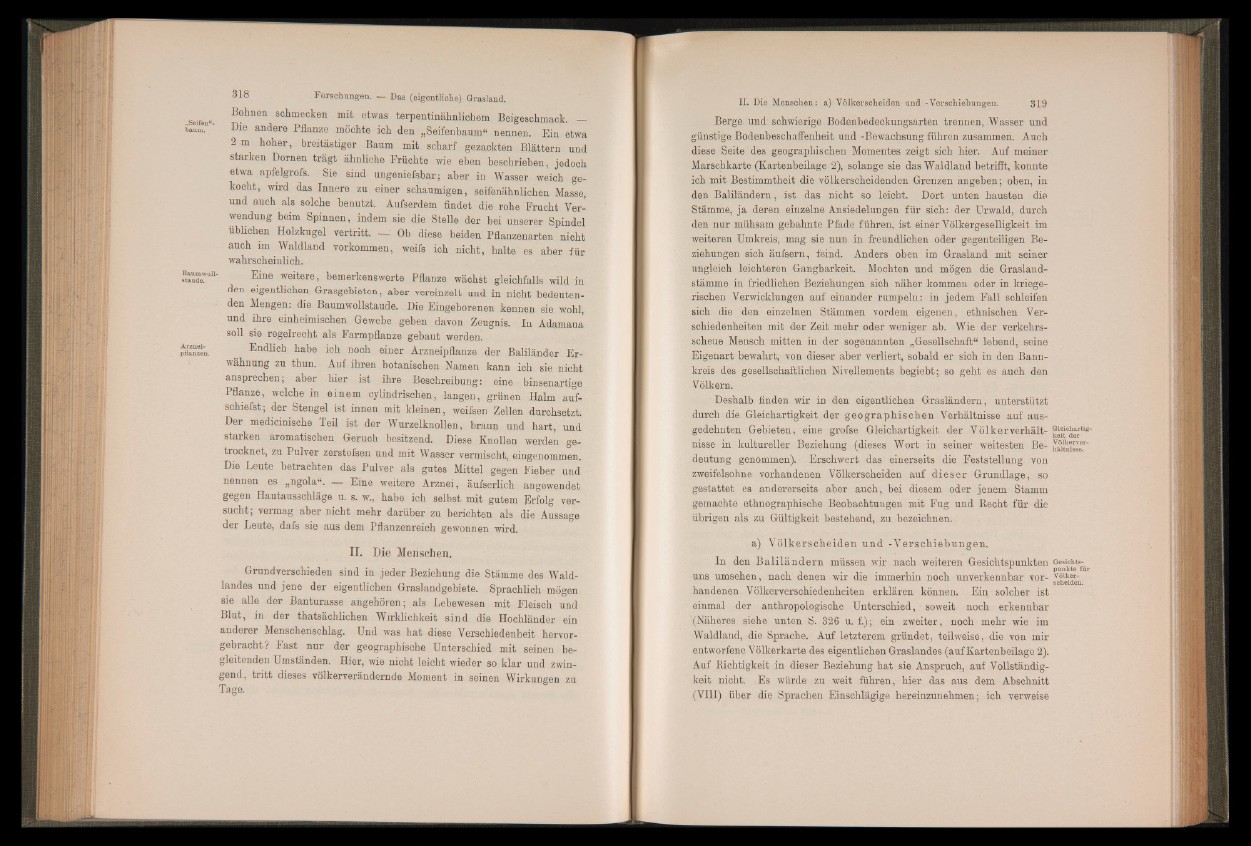
„Seifen“-:
baum.
Baumwollstaude.
Arzneipflanzen.
Bohnen schmecken mit etwas terpentinähnlichem Beigeschmack. —
Die andere Pflanze möchte ich den „Seifenbaum“ nennen. Ein etwa
2 m hoher, breitästiger Baum mit scharf gezackten Blättern und
starken Dornen trä g t ähnliche Früchte wie eben beschrieben, jedoch
etwa apfelgrofs. Sie sind ungenießbar; aber in Wasser weich gekocht,
wird das Innere zu einer schaumigen, seifenähnlichen Masse,
und auch als solche benutzt. Außerdem findet die rohe Frucht Verwendung
beim Spinnen, indem sie die Stelle der bei unserer Spindel
üblichen Holzkugel vertritt. — Ob diese beiden Pflanzenarten nicht
auch im Waldland Vorkommen, weiß ich nicht, halte es aber fü r
wahrscheinlich.
Eine weitere, bemerkenswerte Pflanze wächst gleichfalls wild in
den eigentlichen Grasgebieten, aber vereinzelt und in nicht bedeutenden
Mengen: die Baumwollstaude. Die Eingeborenen kennen sie wohl,
und ihre einheimischen Gewebe geben davon Zeugnis. In Adamaua
soll sie regelrecht als Farmpflanze gebaut werdend
Endlich habe ich noch einer Arzneipflanze der Baliländer E rwähnung
zu thun. Auf ihren botanischen Namen kann ich sie nicht
ansprechen; aber hier ist ihre Beschreibung: eine binsenartige
Pflanze, welche in e in em cylindrischen, langen, grünen Halm aufschiefst;
der Stengel ist innen mit kleinen, weißen Zellen durchsetzt.
Der medicinische Teil ist der Wurzelknollen, braun und h a rt, und
starken aromatischen; Geruch besitzend. Diese Knollen werden getrocknet,
zu Pulver zerstoßen und mit Wasser vermischt, eingenommen.
Die Leute betrachten das Pulver als gutes Mittel gegen Fieber und
nennen es „ngola“. — Eine weitere Arznei, äußerlich angewendet
gegen Hautausschläge u. s. w., habe ich selbst mit gutem Erfolg versucht;
vermag aber nicht mehr darüber zu berichten als die Aussage
der Leute, d a ß sie aus dem Pflanzenreich gewonnen wird.
II. Die Menschen.
Grundverschieden sind in jeder Beziehung die Stämme des Waldlandes
und jene der eigentlichen Graslandgebiete. Sprachlich mögen
sie alle der Banturasse angehören; a ß Lebewesen mit Fleisch und
Blut, in d er thatsächlichen Wirklichkeit s in d die Hochländer ein
anderer Menschenschlag. Und was h a t diese Verschiedenheit hervorgebracht?
Fa st nur der geographische Unterschied mit seinen begleitenden
Umständen. Hier, wie nicht leicht wieder so klar und zwingend,
tr it t dieses völkerverändernde Moment in seinen Wirkungen zu
Tage.
Berge, und schwierige Bodenbedeckungsarten trennen, Wasser und
günstige Bodenbeschaffenheit und -Bewachsung führen zusammen. Auch
diese Seite des geographischen Momentes zeigt sich hier. Auf meiner
Marschkarte (Kartenbeilage 2), solange sie das Waldland betrifft, konnte
ich mit Bestimmtheit die völkerscheidenden Grenzen angeben; oben, in
den B aliländern, ist das nicht so leicht. Dort unten hausten die
Stämme, ja deren einzelne Ansiedelungen fü r sich: der Urwald, durch
den nur mühsam gebahnte Pfade führen, ß t einer Völkergeselligkeit im
weiteren Umkreis, mag sie nun in freundlichen oder gegenteiligen Beziehungen
sich äu ß e rn , feind. Anders oben im Grasland mit seiner
ungleich leichteren Gangbarkeit. Mochten und mögen die Graslandstämme
in friedlichen Beziehungen sich näher kommen oder in kriegerischen
Verwicklungen auf einander rumpeln; in jedem Fall schleifen
sich die den einzelnen Stämmen vordem eigenen, ethnischen Verschiedenheiten
mit der Zeit mehr oder weniger ab. Wie der verkehrsscheue
Mensch mitten in der sogenannten „Gesellschaft“ lebend, seine
Eigenart bewahrt, von dieser aber verliert, sobald er sich in den Bannkreis
des gesellschaftlichen Nivellements begiebt; so geht es auch den
Völkern.
Deshalb finden wir in den eigentlichen Grasländern, unterstützt
durch die Gleichartigkeit der g e o g r a p h is c h e n Verhältnisse auf ausgedehnten
Gebieten, eine große Gleichartigkeit der V o lk e r Verhältnisse
in kultureller Beziehung (dieses Wort in seiner weitesten Bedeutung
genommen). Erschwert das einerseits die Feststellung von
zweifelsohne vorhandenen Völkerscheiden auf d ie s e r Grundlage, so
gestattet es andererseits aber auch, bei diesem oder jenem Stamm
gemachte ethnographische Beobachtungen mit Fug und Recht fü r die
übrigen a ß zu Gültigkeit bestehend, zu bezeichnen.
a) V ö lk e r s c h e id e n u n d -V e r s c h ie b u n g e n .
In den B a l i lä n d e r n müssen wir nach weiteren Gesichtspunkten
uns umsehen, nach denen wir die immerhin noch unverkennbar vorhandenen
Völkerverschiedenheiten erklären können. Ein solcher ist
einmal der anthropologische Unterschied, soweit noch erkennbar
(Näheres siehe unten S. 326 u. f.); ein zweiter, noch mehr wie im
Waldland, die Sprache. Auf letzterem gründet, teilweise, die von mir
entworfene Völkerkarte des eigentlichen Graslandes (auf Kartenbeilage 2).
Auf Richtigkeit in dieser Beziehung h a t sie Anspruch, auf Vollständigkeit
nicht. Es würde zu weit führen, hier das aus dem Abschnitt
(VIII) über die Sprachen Einschlägige hereinzunehmen; ich verweise
Gleichartigk
e it der
Völkerverhältnisse.
Gesichtspunkte
für
Völkerscheiden.