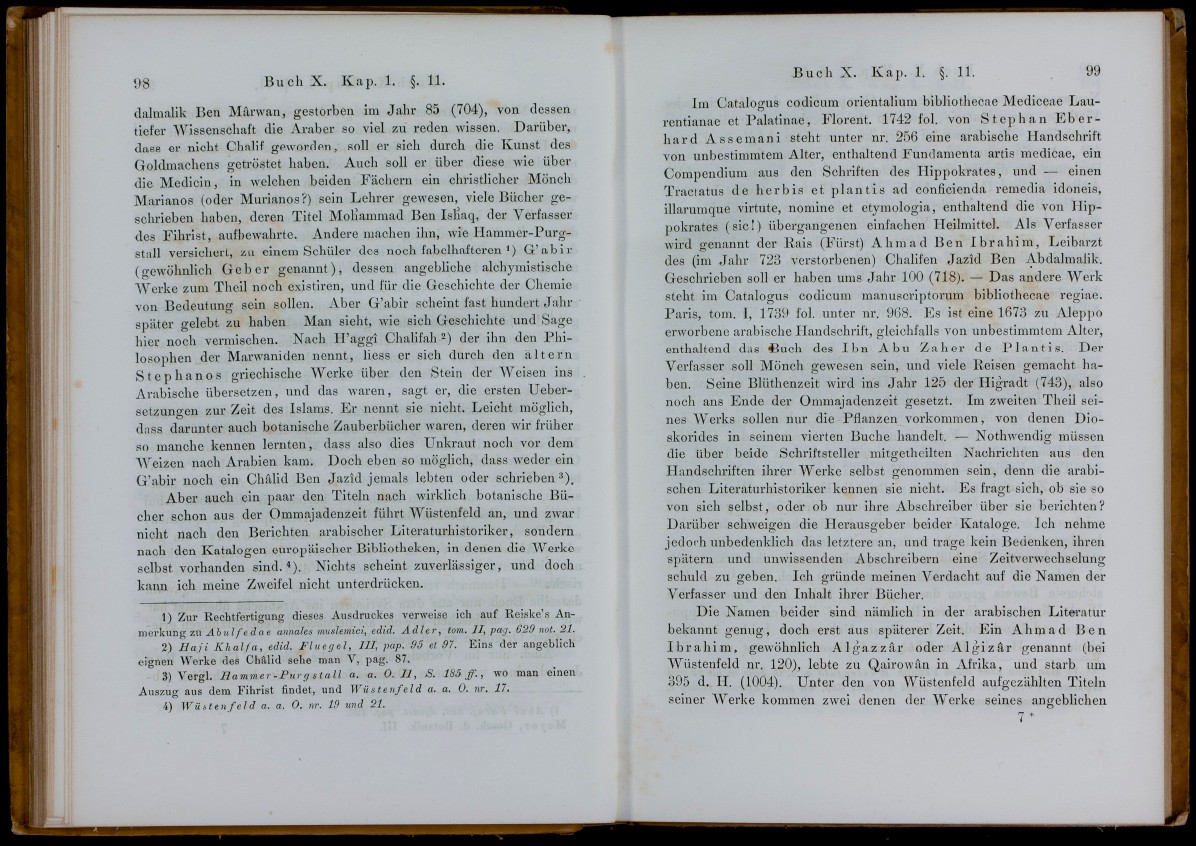
. laa »MI . .. —
I. .1
rji «i
ki- I
98 B u c h X. Kap. 1. §. 11. B u c h X. Kap. 1. §. 11. 99
dahiialik Ben Märwan, gestorben im Jahr 85 (704), von dessen
tiefer AVissenschalt die Araber so viel zu reden wissen. Darüber,
dass er nicht Chalif geworden, soll er sich durch die Kunst des
Goldmachens getröstet haben. Auch soll er über diese wie über
die Medicin, in welchen beiden Fächern ein christlicher Mönch
Marianos (oder Murianos?) sein Lehrer gewesen, viele Bücher geschrieben
haben, deren Titel Moliammad Ben Isliaq, der Verfasser
des Fihrist, aufbewahrte. Andere machen ihn, wie Hammer-Purgstall
versichert, zu einem Schüler des noch fabelhafteren i) G'abir
(o-ewöhnlich Geber genannt), dessen angebliche alchymistische
Werke zum Theil noch existiren, und für die Geschichte der Chemie
von Bedeutung sein sollen. Aber G'abir scheint fast hundert Jahr
später gelebt zu haben. Man sieht, wie sich Geschichte und Sage
hier noch vermischen. Nach H'aggi Chalifah 2) der ihn den Philosophen
der Marwaniden nennt, Hess er sich durch den ältern
S t e p h a n o s griechische Werke über den Stein der Weisen ins
Arabische übersetzen, und das Avaren, sagt er, die ersten Uebersetzungen
zur Zeit des Islams. Er nennt sie nicht. Leicht möglich,
dass darunter auch botanische Zauberbücher waren, deren wir früher
so manche kennen lernten, dass also dies Unkraut noch vor dem
Weizen nach Arabien kam. Doch eben so möglich, dass weder ein
G'abir noch ein Chälid Ben Jazid jemals lebten oder schrieben 3).
Aber auch ein paar den Titeln nach wirklich botanische Bücher
schon aus der Ommajadenzeit führt Wüstenfeld an, und zwar
nicht nach den Berichten arabischer Literaturhistoriker, sondern
nach den Katalogen europäischer Bibliotheken, in denen die Werke
selbst vorhanden sind.'»). Nichts scheint zuverlässiger, und doch
kann ich meine Zweifel nicht unterdrücken.
1) Zur Rechtfertigung dieses Ausdruckes verweise ich auf Eeiske's Anmerkung
zu Ahulfedae annales muslemici, edid. Adler, tom. I I , pag. 629 not. 21.
2) Haji Khalfa, edid. Fluegel, III, pap. 95 et 97. Eins der angeblich
eignen Werke des Chaiid sehe man V, pag. 87.
3) Vergl. Hammer - Pur g stall a. a. 0. I I , S. 185 ff., wo man einen
Auszug aus dem Fihrist findet, und Wüstenfeld a. a. 0. nr. 17.
4) Wüstenfei d a. a. 0. nr. 19 und 21.
Im Catalogus codicum orientalium bibliothecae Mediceae Laurentianae
et Palatinae, Florent. 1742 fol. von Stephan Eberh
a r d Assemani steht unter nr. 256 eine arabische Handschrift
von unbestimmtem Alter, enthaltend Fundamenta artis medicae, ein
Compendium aus den Schriften des liippokrates, und — einen
Tractatus de herbis et plant i s ad conficienda remedia idoneis,
illarumque virtute, nomine et etymologia, enthaltend die von Hippokrates
(sie!) übergangenen einfachen Heilmittel. Als Verfasser
wird genannt der Rais (Fürst) A hma d Ben Ibrahim, Leibarzt
des (im Jahr 723 verstorbenen) Chalifen Jazid Ben Abdalmalik.
Geschrieben soll er haben ums Jahr 100 (718). — Das andere Werk
steht im Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae.
Paris, tom. I, 1739 fol. unter nr. 968. Es ist eine 1673 zu Aleppo
erworbene arabische Handschrift, gleichfalls von unbestimmtem Alter,
enthaltend das iiuch des Ibn Abu Zäher de Plantis. Der
Verfasser soll Mönch gewesen sein, und viele Reisen gemacht haben,
Seine Blüthenzeit wird ins Jahr 125 der Higradt (743), also
noch ans Ende der Ommajadenzeit gesetzt. Im zweiten Theil seines
Werks sollen nur die Pflanzen vorkommen, von denen Dioskorides
in seinem vierten Buche handelt. — Nothwendig müssen
die über beide Schriftsteller mitgetheilten Nachrichten aus den
Plandschriften ihrer Werke selbst genommen sein, denn die arabischen
Literaturhistoriker kennen sie nicht. Es fragt sich, ob sie so
von sich selbst, oder ob nur ihre Abschreiber über sie berichten?
Darüber schweigen die Herausgeber beider Kataloge. Ich nehme
jedoch unbedenklich das letztere an, and trage kein Bedenken, ihren
spätem und unwissenden Abschreibern eine Zeitverwechselung
schuld zu geben. Ich gründe meinen Verdacht auf die Namen der
Verfasser und den Inhalt ihrer Bücher.
Die Namen beider sind nämlich in der arabischen Literatur
bekannt genug, doch erst aus späterer Zeit. Ein Ahmad Ben
I b r a h i m , gewöhnlich Algazzär oder Algizär genannt (bei
Wüstenfeld nr. 120), lebte zu Qairowan in Afrika, und starb um
395 d. H. (1004). Unter den von Wüstenfeld aufgczähken Titeln
seiner Werke kommen zwei denen der Werke seines angeblichen
7 *
i i . h
"tiv/
t-i.^.-;