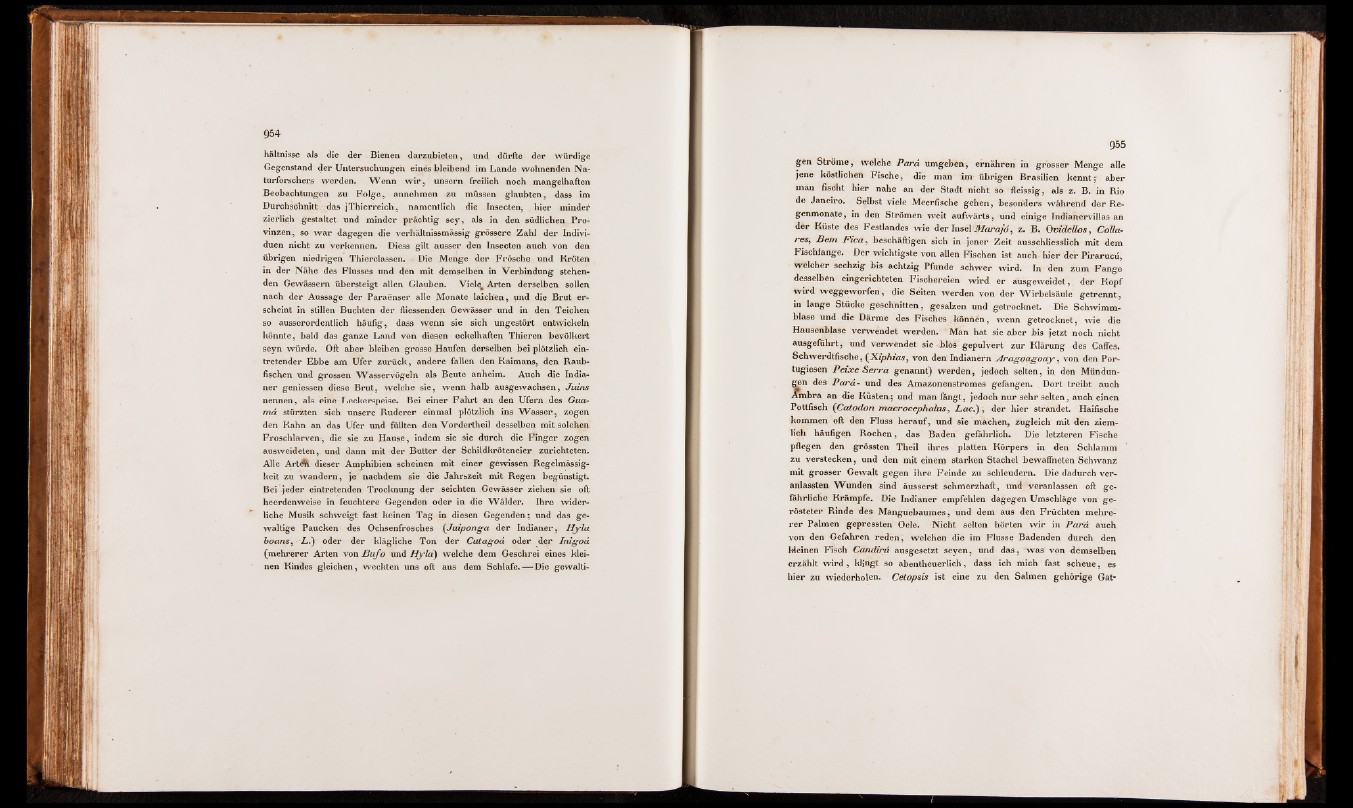
hältnisse als die der Bienen darzubieten, und dürfte der würdige
Gegenstand der Untersuchungen eines bleibend im Lande wohnenden Naturforschers
werden. Wenn w ir , unsern freilich noch mangelhaften
Beobachtungen zu Folge, annehmen zu müssen glaubten, dass im
Durchschnitt das jThierreich, namentlich die Insecten, hier minder
zierlich gestaltet und minder prächtig sey, als in den südlichen Provinzen,
so war dagegen die verhältnissmässig grössere Zahl der Individuen
nicht zu verkennen. Diess gilt ausser den Insecten auch von den
übrigen niedrigen Thierclassen. Die Menge der Frösche und Kröten
in der Nähe des Flusses und den mit demselben in Verbindung stehenden
Gewässern übersteigt allen Glauben. Viele# Arten derselben sollen
nach der Aussage der Paraönser alle Monate laichen, und die Brut erscheint
in stillen Buchten der fliessenden Gewässer und in den Teichen,
so ausserordentlich häufig, dass wenn sie sich ungestört entwickeln
könnte, bald das ganze Land von diesen eckelhaften Thieren bevölkert
seyn würde. Oft aber bleiben grosse Haufen derselben bei plötzlich eintretender
Ebbe am Ufer zurück, andere fallen den Kaimans, den Raubfischen
und grossen Wasservögeln als Beute anheim. Auch die Indianer
gemessen diese Brut, welche sie, wenn halb ausgewachsen, Juins
nennen, als eine Leckerspeise. Bei einer Fahrt an den Ufern des Gua-■
mä stürzten sich unsere Ruderer einmal plötzlich ins Wasser., zogen
den Kahn an das Ufer und füllten den Vordertheil desselben mit solchen
Froschlarven, die sie zu Hause, indem sie sie durch die Finger zogen
ausweideten, und dann mit der Butter der Schildkröteneier zurichteten.
Alle A rtÄ dieser Amphibien scheinen mit einer gewissen Regelmässigkeit
zu wandern, je nachdem sie dié Jahrszeit mit Regen begünstigt.
Bei jeder eintretenden Trocknung der seichten Gewässer ziehen sie oft
heerdenweise in feuchtere Gegenden oder in die Wälder. Ihre widerliche
Musik schweigt fast keinen Tag in diesen Gegenden; und das gewaltige
Paucken des Ochsenfrosches (Juiponga der Indianer, H yla
boartS) L.) oder der klägliche Ton der Cutagoä oder der Inigoä
(mehrerer Arten von B u fo und H yla) welche dem Geschrei eines kleinen
Kindes gleichen, weckten uns oft aus dem Schlafe.— Die gewaltigen
Ströme, welche Para umgeben, ernähren in grosser Menge alle
jene köstlichen Fische, die man im übrigen Brasilien kennt; aber
man fischt hier nahe an der Stadt nicht so fleissig, als z. B. in Rio
de Janeiro. Selbst viele Meerfische gehen, besonders während der Regenmonate
, in den Strömen weit aufwärts, und einige Indianervillas an
der Küste- des Festlandes wie der Insel M a ra jö , z. B. O v id ellos, Golla-
res9 Bern P ic a , beschäftigen sich in jener Zeit ausschliesslich mit dem
Fischfänge. Der wichtigste von allen Fischen ist auch hier der Pirarucd,
welcher sechzig bis achtzig Pfunde schwer wird. In den zum Fange
desselben eingerichteten Fischereien wird er äusgeweidet, der Kopf
wird weggeworfen, die Seiten werden von der Wirbelsäule getrennt,
in lange Stücke geschnitten, gesalzen und getrocknet. Die Schwimmblase
und die Därme des Fisches können, wenn getrocknet, wie die
Hausenblase verwendet werden. ; Man hat sie aber bis jetzt noch nicht
ausgeführt, und verwendet sie blös gepulvert zur Klärung des Caffes.
Schwerdtfische, [X ip h ia s, von den Indianern A ra g o a g o a y , von den Portugiesen
P e ix e S erra genannt) werden, jedoch selten, in den Mündungen
des P a ra - und des Amazonenstromes gefangen. Dort treibt auch
Ambra an die Küsten; und man fangt, jedoch nur sehr selten, auch einen
Pottfisch (Catodon m acrocephalus, L a c .) ; der hier strandet. Haifische
kommen oft den Fluss herauf, und sie machen, zugleich mit den ziemlich
häufigen Rochen, das Baden gefährlich. Die letzteren Fische
pflegen den grössten Theil ihres platten Körpers in den Schlamm
zu verstecken, und den mit einem starken Stachel bewaffneten Schwanz
mit grosser Gewalt gegen ihre Feinde zu schleudern. Die dadurch ver-
anlassten Wunden sind äusserst schmerzhaft, und veranlassen oft gefährliche
Krämpfe. Die Indianer empfehlen dagegen Umschläge von- gerösteter
Rinde des Manguebaumes, und dem aus den Früchten mehrerer
Palmen gepressten Oele. Nicht selten hörten wir in P a ra auch
von den Gefahren reden, welchen die im Flusse Badenden durch den
kleinen Fisch Candiru, ausgesetzt seyen, und das, “was von demselben
erzählt wird , kliitgt so abentheuerlich, dass ich mich fast scheue, es
hier zu wiederholen. Cetopsis ist eine zu den Salmen gehörige Gat