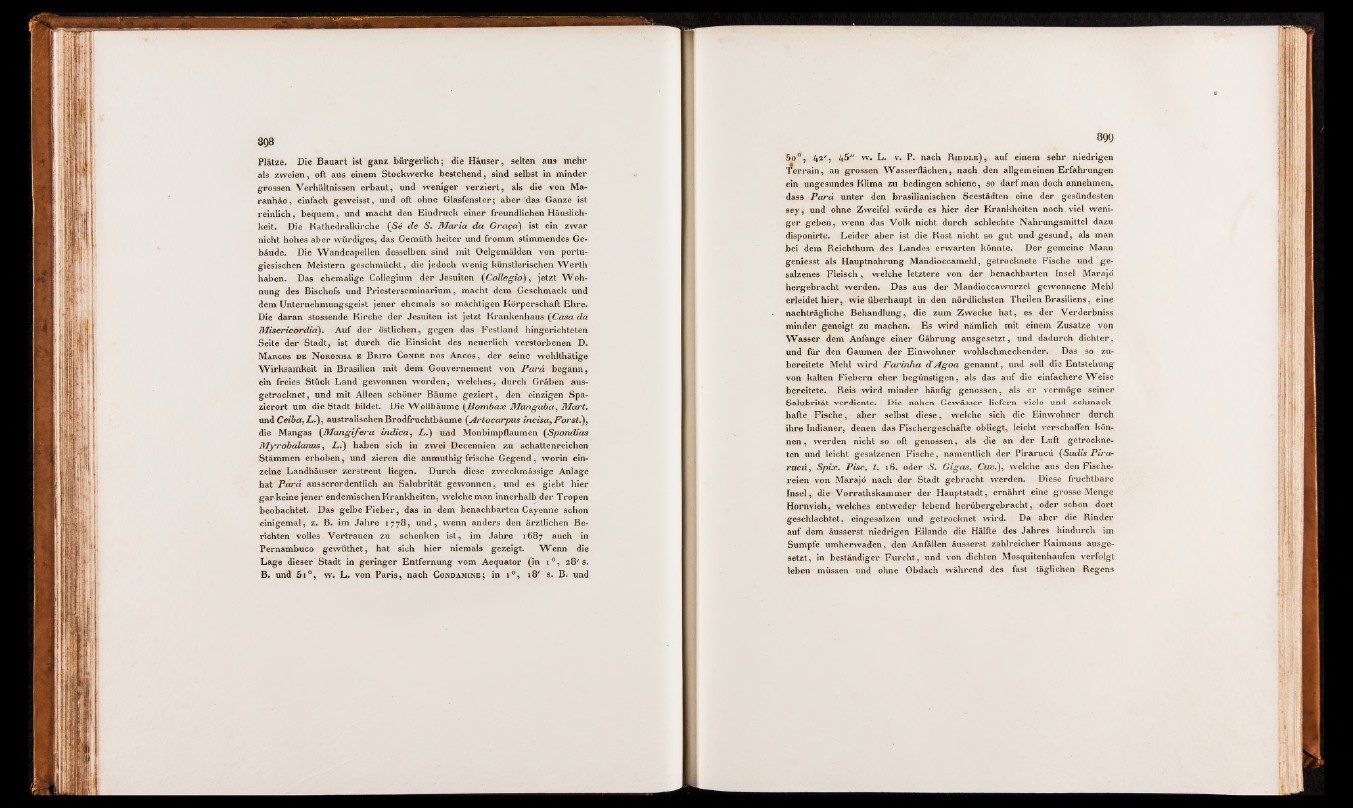
Plätze. Die Bauart ist ganz bürgerlich; die Häuser, selten aue mehr
als zweien, oft aus einem Stockwerke bestehend, sind selbst in minder
grossen Verhältnissen erbaut, und weniger verziert, als die von Ma-
ranhäo, einfach geweisst, und oft ohne Glasfenster; aber das Ganze ist
reinlich, bequem, und macht den Eindruck einer freundlichen Häuslichkeit.
Die Kathedralkirche («Se de S. Maria da Graga) ist ein zwar
nicht hohes aber würdiges, das Gemüth heiter und fromm stimmendes Gebäude.
Die Wandcapellen desselben sind mit Oelgemälden von portugiesischen
Meistern geschmückt, die jedoch wenig künstlerischen Werth
haben. Das ehemalige Collegium der Jesuiten {Collegio), jetzt Wohnung
des Bischofs und Priesterseminarium, macht dem Geschmack und
dem Unternehmungsgeist jener ehemals so mächtigen Körperschaft Ehre.
Die daran stossende Kirche der Jesuiten ist jetzt Krankenhaus (Casa da
Misericordia). Auf der östlichen, gegen das Festland hingerichteten
Seite der Stadt, ist durch die Einsicht des neuerlich verstorbenen D.
Marcos de N oronha e B rito C onde dos A rcos, der seine wohlthätige
Wirksamkeit in Brasilien mit dem Gouvernement von Para begann,
ein freies Stück Land gewonnen worden, welches, durch Gräben ausgetrocknet,
und mit Alleen schöner Bäume geziert, den einzigen Spazierort
um die Stadt bildet. Die Wollbäume (Bombax Manguba, Mart.
und Ceiba, L.), australischen Brodfruchtbäume (Artocarpus incisa, Forst
die Mangas (Mangifera indica, L.~) und Monbimpflaumen (Spondias
Myrobalanus, jL .) haben sich in zwei Decennien zu schattenreichen
Stämmen erhoben, und zieren die anmuthig frische Gegend, worin einzelne
Landhäuser zerstreut liegen. Durch diese zweckmässige Anlage
hat Para ausserordentlich an Salubrität gewonnen, und es giebt hier
gar keine jener endemischen Krankheiten, welche man innerhalb der Tropen
beobachtet. Das gelbe Fieber, das in dem benachbarten Cayenne schon
einigemal, z. B. im Jahre 1778, und, wenn anders den ärztlichen Berichten
volles Vertrauen zu schenken ist, im Jahre 1687 auch in
Pernambuco gewüthet, hat sich hier niemals gezeigt. Wenn die
Lage dieser Stadt in geringer Entfernung vom Aequator (in i ° , 28's.
B. und 5 i ° , w . L. von Paris, nach Condamine; in i ° , 18' s. B. und
5o°, Z|2/, 45" w. L. v. P. nach Riddle) , auf einem sehr niedrigen
Terrain, an grossen Wasserflächen, nach den allgemeinen Erfahrungen
ein ungesundes Klima zu bedingen schiene, so darf man doch annehmen,
dass Para unter den brasilianischen Seestädten eine der gesündesten
sey, und ohne Zweifel würde es hier der Krankheiten noch viel weniger
geben, wenn das Volk nicht durch schlechte Nahrungsmittel dazu
disponirte. Leider aber ist die Kost nicht so gut und gesund, als man
bei dem Reichthum des Landes erwarten könnte. Der gemeine Mann
geniesst als Hauptnahrung Mandioccamehl, getrocknete Fische und gesalzenes
Fleisch, welche letztere von der benachbarten Insel Marajö
hergebracht werden. Das aus der Mandioccawurzel gewonnene Mehl
erleidet hier, wie überhaupt in den nördlichsten Theilen Brasiliens, eine
nachträgliche Behandlung, die zum Zwecke hat, es der Verderbniss
minder geneigt zu machen. Es wird nämlich mit einem Zusatze von
Wasser dem Anfänge einer Gährung ausgesetzt, und dadurch dichter,
und für den Gaumen der Einwohner wohlschmeckender. Das so zubereitete
Mehl wird Farinha dCAgoa genannt, und soll die Entstehung
von kalten Fiebern eher begünstigen, als das auf die einfachere Weise
bereitete. Reis wird minder häufig genossen, als er vermöge seiner
Salubrität verdiente. Die nahen Gewässer liefern viele und schmackhafte
Fische, aber selbst diese, welche sich die Einwohner durch
ihre Indianer, denen das Fischergeschäfte obliegt, leicht verschaffen können
, werden nicht so oft genossen, als die an der Luft getrockneten
und leicht gesalzenen Fische, namentlich der Pirarucü {Sadis Pira-
rucu, Spix. Pisc. t. 16. oder <S. Gigas., Cmu.), welche aus den Fischereien
von Marajö nach der Stadt gebracht werden. Diese fruchtbare
Insel, die Vorrathskammer der Hauptstadt, ernährt eine grosse Menge
Hornvieh, welches entweder lebend herübergebracht, oder schon dort
geschlachtet, eingesalzen und getrocknet wird. Da aber die Rinder
auf dem äusserst niedrigen Eilande die Hälfte des Jahres hindurch im
Sumpfe umherwaden, den Anfallen äusserst zahlreicher Kaimans ausgesetzt,
in beständiger Furcht, und von dichten Mosquitenhaufen verfolgt
leben müssen und ohne Obdach während des fast täglichen Regens