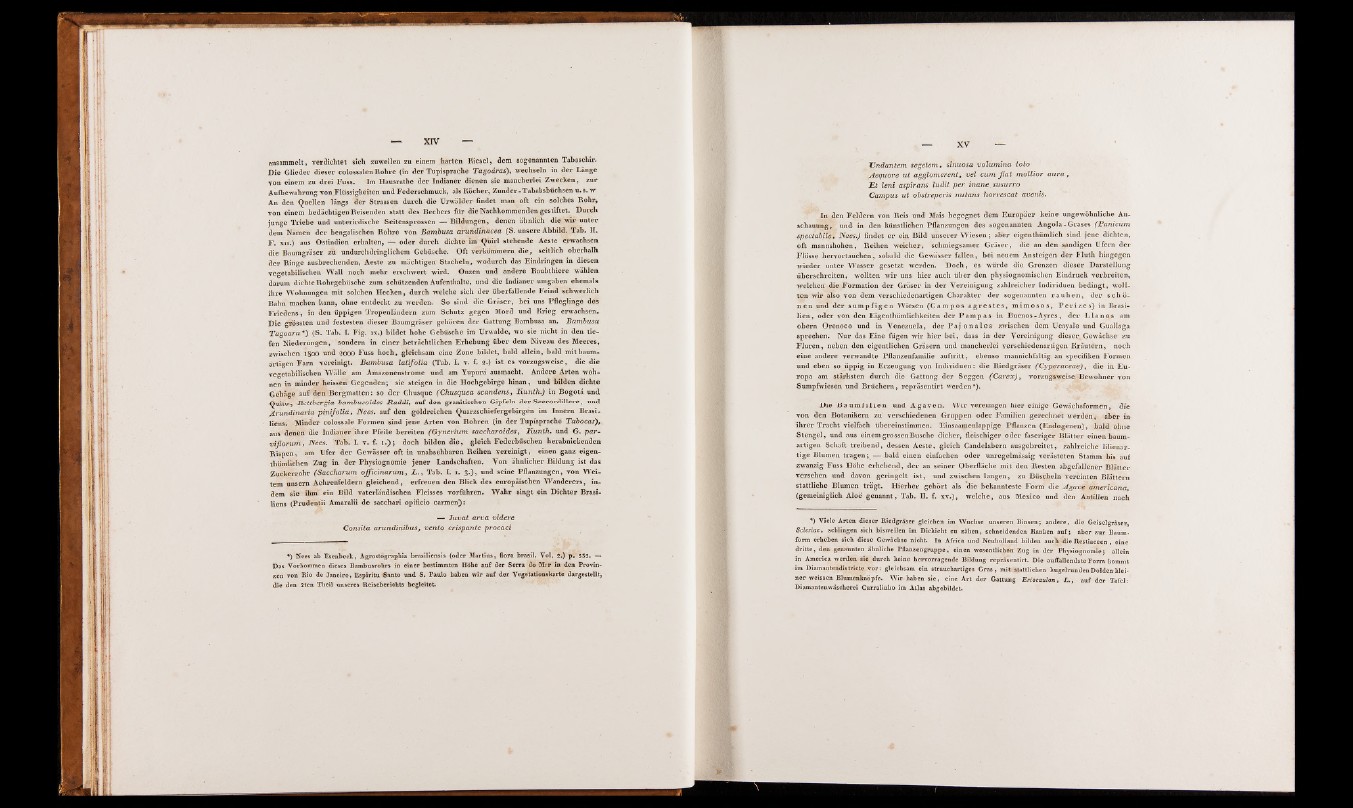
ansammelt, verdichtet sich zuweilen zu einem harten Kiesel, dem sogenannten Tabaschir.
Die Glieder dieser colossalen Rohre (in der Tupisprache Tagoaras), wechseln in der Länge
von einem zu drei Fuss. Im Hausrathe der Indianer dienen sie mancherlei Zwecken, zur
Aufbewahrung von Flüssigkeiten und Federschmuck, als Köcher, Zunder-Tabaksbüchsen u. s. w
An den Quellen längs der Strassen durch die Urwälder findet man oft ein solches Rohr,
von einem bedächtigen Reisenden statt des Bechers für die Nachkommenden gestiftet. Durch
junge Triebe und unterirdische Seitensprossen — Bildungen, denen ähnlich die wir unter
dem Namen der bengalischen Rohre von Bambusa aruridinäcea (S. unsere Abbild. Tab. II.
F. xii.) aus Ostindien erhalten, — oder durch dichte im Quirl stehende Aeste erwachsen
die Baumgräser zu undurchdringlichem Gebüsche. Oft verkümmern, die, seitlich oberhalb
der Ringe ausbrechenden, Aeste zu mächtigen Stacheln, wedurch das Eindringen in diesen
vegetabilischen Wall noch mehr erschwert wird. Onzen und andere Raubthiere wählen
darum dichte Rohrgebüsche zum schützenden Aufenthalte, und die Indianer umgaben ehemals
ihre Wohnungen mit solchen Hecken, durch welche sich der überfallende Feind scbwerlich
Bahn machen kann, ohne entdeckt zu werden. So sind die Gräser, bei uns Pfleglinge des
Friedens, in den üppigen Tropenländern zum Schutz gegen Mord und Krieg erwachsen.
Die grössten und festesten dieser Baumgräser gehören der Gattung Bambusa an. Bambusa
Tagoara*) (S. Tab. I. Fig. ix.) bildet hohe Gebüsche im Urwalde, wo sie nicht in den tiefen
Niederungen, sondern in einer beträchtlichen Erhebung über dem Niveau des Meeres,
zwischen igoo und 2000 Fuss hoch, gleichsam eine Zone bildet, bald allein, bald mit baumartigen
Farn vereinigt. Bambusa latifolia (Tab. I. v. f. 2.) ist es vorzugsweise, die die
vegetabilischen Wälle am Amazonenstrome und am Tupurä ausmacht. Andere Arten wohnen
in minder heissen Gegenden; sie steigen in die Hochgebirge binan, und bilden dichte
Gehäge auf den Bergmatten: so der Chusque (Chusquea scandens, Kunth.) in Bogota und
Quito ; Rettbergia bambusoides Raddi, auf den granitischen Gipfeln der Scecordillere, und
Arundinaria pinifoliä, ISees. auf den goldreichen Quarzschiefergebirgen im Innern Brasiliens:
Minder colössale Formen sind jene Arten von Rohren (in der Tupisprache Tabocas),
aus denen die Indianer ihre Pfeile bereiten (Gynerium saccharoides, Kunth. und G. par-
vißorum, Nees. Tab. I. v. f. l . ) ; doch bilden die, gleich Federbüschen herabnickenden
Rispen, am Ufer der Gewässer oft in unabsehbaren Reiben vereinigt, einen ganz eigen-
thümlichen Zug in der Physiognomie jener Landschaften. Yon ähnlicher Bildung ist das
Zuckerrohr (Saccharum officinarum, L . , Tab. I. B 3.), und seine Pflanzungen, von Weitem
unsern Aehrenfeldern gleichend, erfreuen den Blick des europäischen Wanderers, indem
sie ihm ein Bild vaterländischen Fleisses vorführen. Wahr singt ein Dichter Brasiliens
(Prudentii Amaralii de sacchari opificio carmen):
— Juvat arva videre
Consita arundinibus, vento crispante procaci
*) Nees ab Esenbeck, Agrostögraphia brasiliensis (oder Martiüs, flora brasil. Vol. 2.) p ; 532. —•
Das Vorkommen dieses Bambusrohrs in einer bestimmten Höhe auf der Serra do Mrr in den Provinzen
von Rio de Janeiro, Espiritu’Santo und S. Paulo haben wir auf der Vegetationskarte dargestellt,
die den 2ten Theil unseres Reiseberichts begleitet.
TJndantem segetem, sinuosa tioîiimina toto
Aequore ut agglomèrent, vel cum ß a t mollior aura,
E t leni aspirans ludit per- inane, susurro
Campus ut obstreperis nutans horrescat avenis.
In den Feldern von Reis und Mais begegnet dem Europäer keine ungewöhnliche Anschauung,
und in den künstlichen Pflanzungen des sogenannten Angola - Grases (Panicum
spectabile, Nees.) findet er ein Bild unserer Wiesen; aber eigenthümlich sind jene dichten,
oft mannshohen, Reihen weicher, schmiegsamer Gräser, die an den sandigen Ufern der
Flüsse hervortauchen, sobald die Gewässer fallen, bei neuem Ansteigen der Fluth hingegen
wieder unter Wasser gesetzt werden. Doch, es würde die. Grenzen dieser , Darstellung
überschreiten, wollten wir uns hier auch über den physiognomischen Eindruck verbreiten,
welchen die Formation der Gräser in der Vereinigung zahlreicher Individuen bedingt, wollten
wir also von dem verschiedenartigen Charakter der sogenannten ra u h e n , der s c h ö n
e n und der s um p f ig e n Wiesen (C am p o s a g r e s t e s , m im o s o s , P e r i z e s ) in Brasilien,
oder von den Eigenthümlichkeiten der P am p a s in Buenos - Ayres, der L la n o s am
obern Orenoco und in Venezuela, der P a j o n a le s zwischen dem Ucayale und Guallaga
sprechen. Nur das Eine fügen wir hier bei, dass in der Vereinigung dieserv Gewächse zu
Fluren, neben den eigentlichen Gräsern und mancherlei verschiedenartigen Kräutern, noch
eine andere verwandte Pflanzenfamilie auftritt, ebenso mannichfaltig an specifiken Formen
und eben so üppig in Erzeugung von Individuen: die Riedgräser (Cypgraceae), die in Europa
am stärksten durch die Gattung der Seggen (CarexJ, vorzugsweise.-Bewohner von
Sumpfwiesen und Brüchern, repräsentirt werden*).
Die B a u m l i l ie n und A g a v e n . Wir vereinigen hier einige Gewächsformen, die
von den Botanikern zu verschiedenen Gruppen oder Familien gerechnet werden,- aber in-
ihrer Tracht vielfach übereinstimmen. Einsaaipenlappige Pflanzen (Endogenen), bald ohne
Stengel, und aus einem grossen Busche dicker, fleischiger oder faseriger Blätter einen baumartigen
Schaft treibend, dessen Aeste, gleich Candelabern ausgebreitet, zahlreiche lilienartige
Blumen tragen; — bald einen einfachen oder unregelmässig verästeten Stamm bis auf
zwanzig Fuss Höhe erhebend, der an seiner Oberfläche mit den Resten abgefajlenèr Blätter
versehen und davon geringelt is t, und zwischen langen, zu Büscheln vereinten Blättern
stattliche Blumen trägt. Hierher gehört als 'die bekannteste Form die Agave americana
(gemeiniglich Aloe genannt, Tab. II. f. xv .), welche, aus Mexico und den Antillen nach
*) Viele Arten dieser Riedgräser gleichen im Wüchse unseren Binsen; andere, die Geiselgräser,
Scleriae, schlingen sich bisweilen im Dickicht zu zähen, schneidenden Ranken auf; aber zur Baum-
form erheben sich diese Gewächse nicht. In Africa und Neuholland bilden auch die Restiaceen, eine
dritte, den genannten ähnliche Pflanzengruppe, einen wesentlichen: Zug in der Physiognomie; allein
in America werden sie durch keine hervorragende Bildung repräsentirt. Die auffallendste Form kommt
im Diamantendistricte Vor: gleichsam ein strauchartiges Gras, mitvstattlichen kugelrunden Dolden klei-
ner weissen Blumenknöpfc. Wir haben sie, eine Art der Gattung Eriocaulon, L ., auf der Tafel:
Diamantenwäscherei Curralinho im Atlas abgebildet.