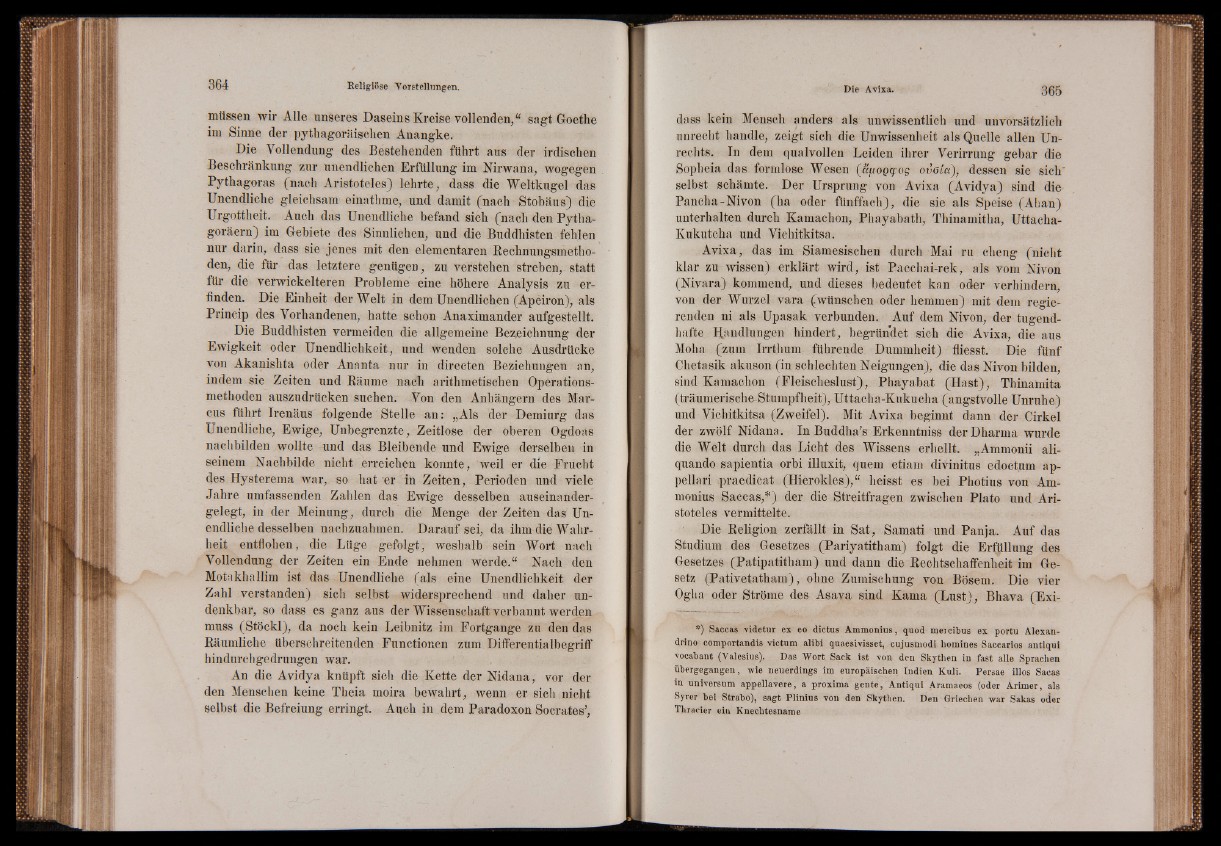
müssen wir Alle unseres Daseins Kreise vollenden,“ sagt Goethe
im Sinne der pythagoräisclien Anangke.
Die Vollendung des Bestehenden führt aus der irdischen
Beschränkung zur unendlichen Erfüllung im Nirwana, wogegen
Pythagoras (nach Aristoteles) lehrte, dass die Weltkugel das
Unendliche gleichsam einathme, und damit (nach Stobäus) die
Urgottheit. Auch das Unendliche befand sich (nach den Pytha-
goräern) im Gebiete des Sinnlichen, und die Buddhisten fehlen
nur darin, dass sie jenes mit den elementaren Rechnungsmethoden,
die für das letztere genügen, zu verstehen streben, statt
für die verwickelteren Probleme eine höhere Analysis zu erfinden.
Die Einheit der Welt in dem Unendlichen (Apéiron)> als
Princip des Vorhandenen, hatte schon Anaximander aufgestellt.
Die Buddhisten vermeiden die allgemeine Bezeichnung der
Ewigkeit oder Unendlichkeit, und wenden solche Ausdrücke
von Akanishta oder Ananta nur in directen Beziehungen an,
indem sie Zeiten und Räume nach arithmetischen Operationsmethoden
auszudrUcken suchen. Von den Anhängern des Marcus
führt Irenäus folgende Stelle a n : „Als der Demiurg das
Unendliche, Ewige, Unbegrenzte, Zeitlose der oberen Ogdoas
nachbilden wollte und das Bleibende und Ewige derselben in
seinem Nachbilde nicht erreichen konnte, weil er die Frucht
des Hysterema war, so hat er in Zeiten, Perioden und viele
Jahre umfassenden Zahlen das Ewige desselben auseinandergelegt,
in der Meinung, durch die Menge der Zeiten das Unendliche
desselben nachzuahmen. Darauf sei, da ihm die Wahrheit
entflohen, die Lüge gefolgt, weshalb sein Wort nach
Vollendung der Zeiten ein Ende nehmen werde.“ Nach den
Motakhallim ist das Unendliche (als eine Unendlichkeit der
Zahl verstanden) sich selbst widersprechend und daher undenkbar,
so dass es ganz aus der Wissenschaft verbannt werden
muss (Stöckl), da noch kein Leibnitz im Fortgange zu den das
Räumliche überschreitenden Functionen zum Differentialbegriff
hindurchgedrungen war.
An die Avidya knüpft sich die Kette der Nidana, vor der
den Menschen keine Theia moira bewahrt, wenn er sich nicht
selbst die Befreiung erringt. Auch in dem Paradoxon Sócrates’,
dass kein Mensch anders als unwissentlich und unvorsätzlich
unrecht handle, zeigt sich die Unwissenheit als Quelle allen Unrechts.
In dem qualvollen Leiden ihrer Verirrung gebar die
Soplieia das formlose Wesen (auogqog ovöia), dessen sie sich'
selbst schämte. Der Ursprung von Avixa (Avidya) sind die
Pancha-Nivon (ha oder fünffach), die sie als Speise (Alian)
unterhalten durch Kamachon, Phayabath, Thinamitha, Uttacha-
Kukutcha und Vichitkitsa.
Avixa, das im Siamesischen durch Mai ru cheng (nicht
klar zu wissen) erklärt wird, ist Pacchai-rek, als vom Nivon
(Nivara) kommend,, und dieses bedeutet kan oder verhindern,
von der Wurzel vara (wünschen oder hemmen) mit dem regierenden
ni als Upasak verbunden. Auf dem Nivon, der tugendhafte
Handlungen hindert, begründet sich die Avixa, die aus
Moha (zum Irrthum führende Dummheit) fliesst. Die fünf
Chetasik akuson (in schlechten Neigungen), die das Nivon bilden,
sind Kamachon (Fleischeslust), Phayabat (H a st), Thinamita
(träumerische Stumpfheit), Uttacha-Kukucha (angstvolle Unruhe)
und Vichitkitsa (Zweifel). Mit Avixa beginnt dann der Cirkel
der zwölf Nidana. In Buddha’s Erkenntniss derDharma wurde
die Welt durch das Licht des Wissens erhellt. „Ammonii ali-
quando sapientia orbi illuxit, quem etiam divinitus edoctum ap-
pellari praedicat (Hierokles), “ lieisst es bei Photius von Am-
monius SaccaS;*) der die Streitfragen zwischen Plato und Aristoteles
vermittelte.
Die Religion zerfällt in S a t, Samati und Panja. Auf das
Studium des Gesetzes (Pariyatitham) folgt die Erfüllung des
Gesetzes (Patipatitham) und dann die Rechtschaffenheit im Gesetz
(Pativetatham), ohne Zumischung von Bösem. Die vier
Ogha oder Ströme des Asava sind Kama (Lu st), Bhava (Exi-
*) Saccas videtur ex eo dictus Ammonius, quod meicibus ex portu Alexan-
drlno comportandis victum alibi quaesivisset, cujusmodi homines Saccarios antiqui
vocabant (Valesius). Das Wort Sack ist von den Skythen in fast alle Sprachen
übergegangen, wie neuerdings im europäischen Indien Kuli. Persae illos Sacas
in Universum appellavere, a proxima gente, Antiqui Aramaeos (oder Arimer, als
Syrer bei Strabo), sagt Plinius von den Skythen. Den Griechen war Sakas oder
Thracier ein Knechtesname