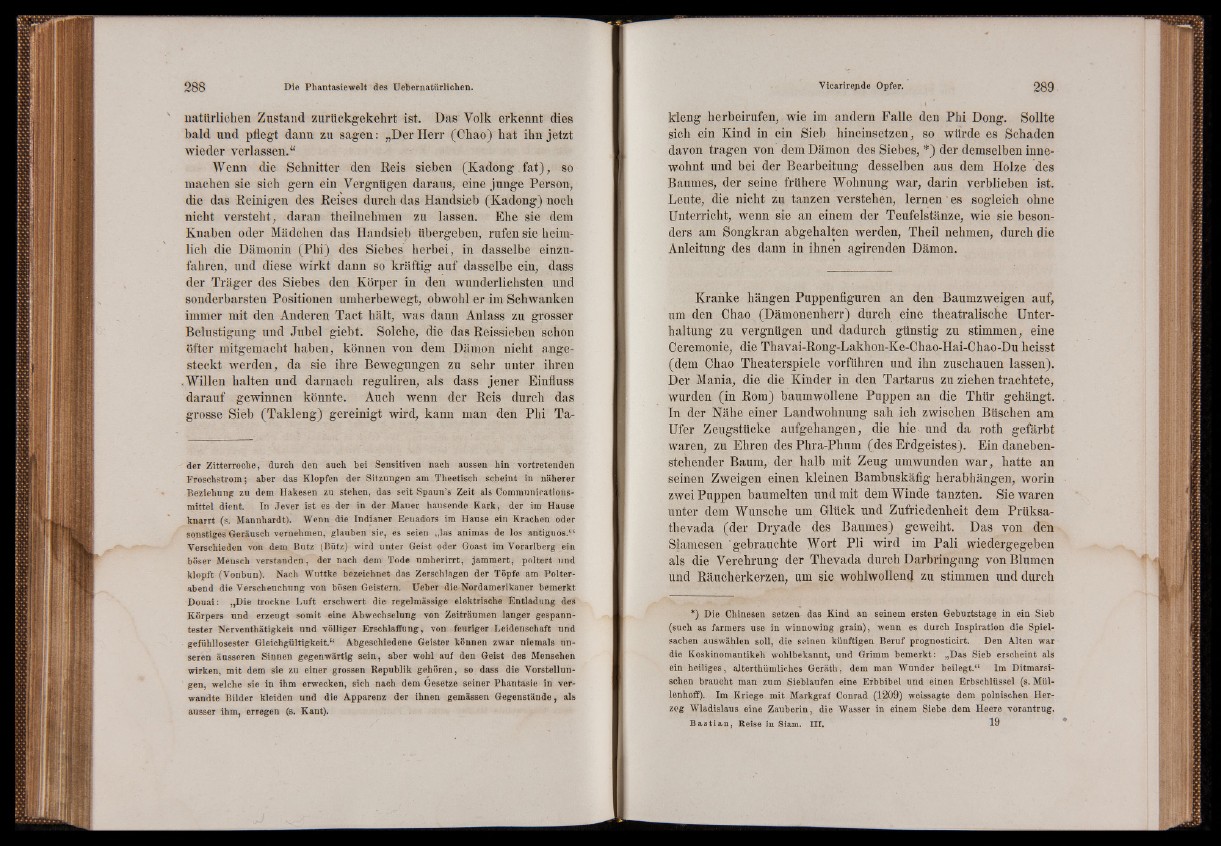
natürlichen Zustand zurückgekehrt ist. Das Yolk erkennt dies
bald und pflegt dann zu sagen: „Der H err (Chao) hat ihn jetzt
wieder verlassen.“
Wenn die Schnitter den Reis sieben (Kadong fa t), so
machen sie sich gern ein Vergnügen daraus, eine junge Person,
die das Reinigen des Reises durch das Handsheb (Kadong) noch
nicht versteht, daran theilnehmen zu lassen. Ehe sie dem
Knaben oder Mädchen das Handsieb übergeben, rufen sie heimlich
die Dämonin (Phi) des Siebes herbei, in dasselbe einzufahren,
und diese wirkt dann so kräftig auf dasselbe ein, dass
der Träger des Siebes den Körper in den wunderlichsten und
sonderbarsten Positionen umherbewegt, obwohl er im Schwanken
immer mit den Anderen Tact hält, was dann Anlass zu grösser
Belustigung und Jubel giebt. Solche, die das Reissieben schon
öfter mitgemacht haben, können von dem Dämon nicht angesteckt
werden, da sie ihre Bewegungen zu sehr unter ihren
.Willen halten und darnach reguliren, als dass jener Einfluss
darauf gewinnen könnte. Auch wenn der Reis durch das
grosse Sieb (Takleng) gereinigt wird, kann man den Phi Tader
Zitterroehe, durch den auch hei Sensitiven nach aussen hin vortretenden
Froschstrom; aber das Klopfen der Sitzungen am Theetisch scheint in näherer
Beziehung zu dem Hakesen zu stehen, das seit Spaun’s Zeit als Communieations-
mittel dient. In Jever ist es der in der Mauer hausende Kark, der im Hause
knarrt (s, Mannhardt). Wenn die Indianer Ecuadors im Hause ein Krachen oder
sonstiges Geräusch vernehmen, glauben sie, es seien „las animas de los aotiguos.“
Verschieden von dem Butz (Butz) wird unter Geist oder Goast im Vorarlberg ein
böser Meusch verstanden, der nach dem Tode umherirrt, jammert, poltert und
klopft (Vonbun). Nach Wuttke bezeichnet das Zerschlagen der Töpfe am Polterabend
die Verscheuchung von bösen Geistern. Ueber die Nordamerikaner bemerkt
Douai: „Die trockne Luft erschwert die regelmässige elektrische Entladung des
Körpers und erzeugt somit eine Abwechselung von Zeiträumen langer gespanntester
Nerventhätigkeit und völliger Erschlaffung, von feuriger Leidenschaft und
gefühllosester Gleichgültigkeit.“ Abgeschiedene Geister können zwar niemals unseren
äusseren Sinnen gegenwärtig sein, aber wohl auf den Geist des Menschen
wirken, mit dem sie zu einer grossen Republik gehören, so dass die Vorstellungen,
welche sie in ihm erwecken, sich nach dem Gesetze seiner Phantasie in verwandte
Bilder kleiden und die Apparenz der ihnen gemässen Gegenstände, als
ausser ihm, erregen (s. Kant).
kleng herbeirufen, wie im ändern Falle den Phi Dong. Sollte
sich ein Kind in ein Sieb hineinsetzen, so würde es Schaden
davon tragen von dem Dämon des Siebes, *) der demselben innewohnt
und bei der Bearbeitung desselben aus dem Holze des
Baumes, der seine frühere Wohnung war, darin verblieben ist.
Leute, die nicht zu tanzen verstehen, le rn e n ' es sogleich ohne
Unterricht, wenn sie an einem der Teufelstänze, wie sie besonders
am Songkran abgehalten werden, Theil nehmen, durch die
Anleitung des dann in ihnen agirenden Dämon.
Kranke hängen Puppenfiguren an den Baumzweigen auf,
um den Chao (Dämonenherr) durch eine theatralische Unterhaltung
zu vergnügen und dadurch günstig zu stimmen, eine
Ceremonie, die Thavai-Rong-Lakhon-Ke-Chao-Hai-Chao-Du heisst
(dem Chao Theaterspiele vorführen und ihn zuschauen lassen).
Der Mania, die die Kinder in den Tartarus zu ziehen trachtete,
wurden (in Rom) baumwollene Puppen an die Thür gehängt.
In der Nähe einer Landwohnung sah ich zwischen Büschen am
Ufer Zeugstücke aufgehangen, die hie- und da roth gefärbt
waren, zu Ehren des Phrä-Phum (des Erdgeistes). Ein danebenstehender
Baum, der halb mit Zeug umwunden w a r, hatte an
seinen Zweigen einen kleinen Bambuskäfig herabhängen, worin
zwei Puppen baumelten und mit dem Winde tanzten. Sie waren
unter dem Wunsche um Glück und Zufriedenheit dem Prüksa-
thevada (der Dryade des Baumes) geweiht. Das von den
Siamesen gebrauchte Wort Pli wird im Pali wiedergegeben
als die Verehrung der Thevada durch Darbringung von Blumen
und Räucherkerzen, um sie wohlwollend zu stimmen und durch
*) Die Chinesen setzen- das Kind an seinem ersten Geburtstage in ein Sieb
(such as farmers use in winnowing grain), wenn es durch Inspiration die Spielsachen
auswählen soll, die seinen künftigen Beruf prognosticirt. Den Alten war
die Koskinomantikeh wohlbekannt, und Grimm bemerkt: „Das Sieb erscheint als
ein heiliges, alterthümliches Geräth, dem man Wunder beilegt.“ Im Ditmarsi-
schen braucht man zum Sieblaufen eine Erbbibel und einen Erbschlüssel (s. Mül-
lenhoff). Im Kriege mit Markgraf Conrad (1209) weissagte dem polnischen Herzog
Wladislaus eine Zauberin, die Wasser in einem Siebe dem Heere vorantrug.
B a s t i a n , R eise in Siam. I I I . 19