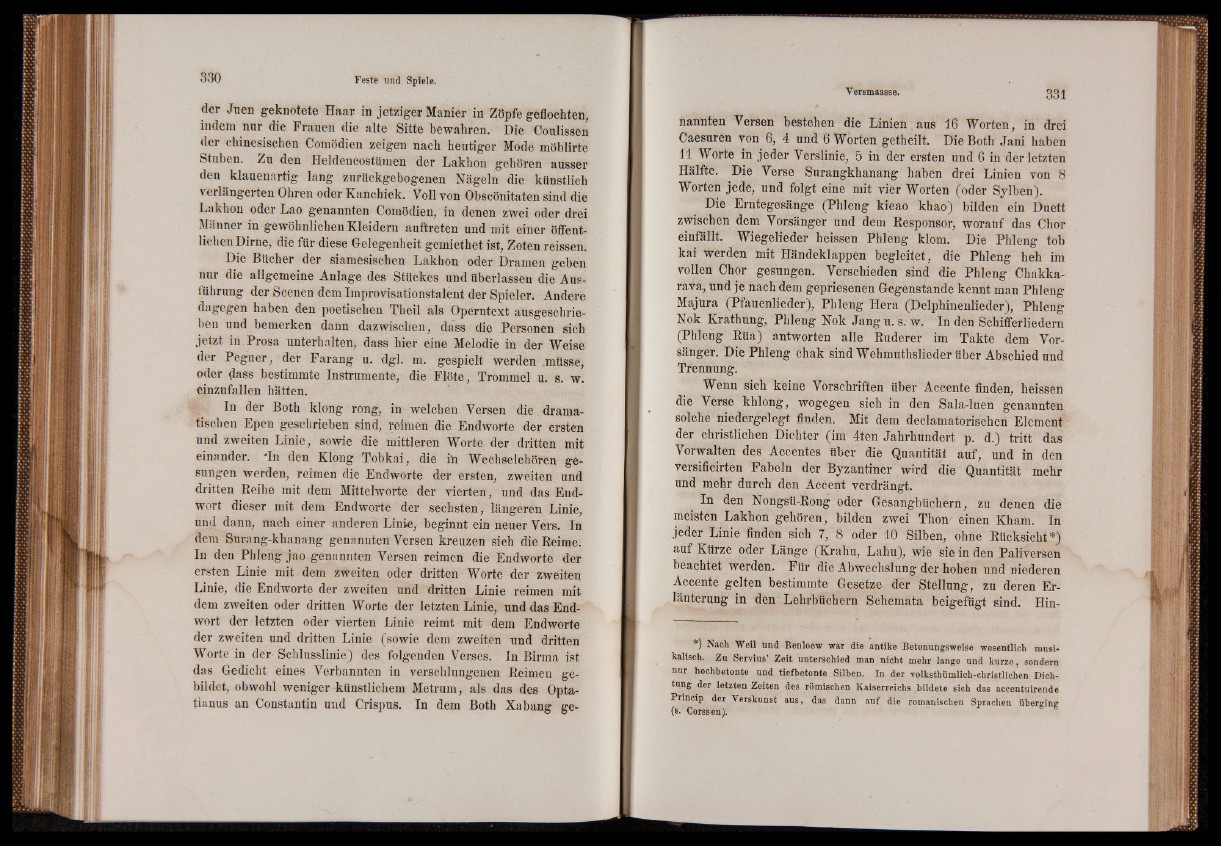
der Juen geknotete Haar in jetziger Manier in Zöpfe geflochten,
indem nur die Frauen die alte Sitte bewahren. Die Coulissen
der chinesischen Comödien zeigen nach heutiger Mode möblirte
Stuben. Zu den Heldencostümen der Lakhon gehören ausser
den klauenartig lang zurückgebogenen Nägeln die künstlich
verlängerten Ohren oder Kanchiek. Voll von Obscönitaten sind die
Lakhon oder Lao genannten Comödien, in denen zwei oder drei
Männer in gewöhnlichen Kleidern auftreten und mit einer öffentlichen
Dirne, die für diese Gelegenheit gemiethet ist, Zoten reissen.
Die Bücher der siamesischen Lakhon oder Dramen geben
nur die allgemeine Anlage des Stückes und überlassen die Ausführung
der Scenen dem Improvisationstalent der Spieler. Andere
dagegen haben den poetischen Theil als Operntext ausgeschrieben
und bemerken dann dazwischen, dass die Personen sich
jetzt in Prosa unterhalten, dass hier eine Melodie in der Weise
der Peguer, der Farang u. dgl. m. gespielt werden müsse,
oder dass bestimmte Instrumente, die Flöte, Trommel u. s. w.
einzufallen hätten.
In der Both klong rong, in welchen Versen die dramatischen
Epen geschrieben sind, reimen die Endworte der ersten
und zweiten Linie, sowie die mittleren Worte der dritten mit
einander. 'In den Klong Tobkai, die in Wechselchören gesungen
werden, reimen die Endworte der ersten, zweiten und
dritten Reihe mit dem Mittelworte der vierten, und das Endwort
dieser mit dem Endworte der sechsten, längeren Linie,
und dann, nach einer anderen Linie, beginnt ein neuer Vers. In
dem Surang-khanang genannten Versen kreuzen sich die Reime.
In den Phleng jao genannten Versen reimen die Endworte der
ersten Linie mit dem zweiten oder dritten Worte der zweiten
Linie, die Endworte der zweiten und dritten Linie reimen mit
dem zweiten oder dritten Worte der letzten Linie, und das Endwort
der letzten oder vierten Linie reimt mit dem Endworte
der zweiten und dritten Linie (sowie dem zweiten und dritten
Worte in der Schlusslinie) des folgenden Verses. In Birma ist
das Gedicht eines Verbannten in verschlungenen Reimen gebildet,
obwohl weniger künstlichem Metrum, als das des Opta-
tianus an Constantjn und Crispus, In dem Both Xabang genannten
Versen bestehen die Linien aus 16 Worten, in drei
Caesuren von 6, 4 und 6 Worten getheilt. Die Both Jani haben
11 Worte in jeder Verslinie, 5 in der ersten und 6 in der letzten
Hälfte. Die Verse Surangkhanang haben drei Linien von 8
Worten jede, und folgt eine mit vier Worten (oder Sylben).
Die Erntegesänge (Phleng kieao khao) bilden ein Duett
zwischen dem Vorsänger und dem Responsor, worauf das Chor
einfällt. Wiegelieder heissen Phleng klom. Die Phleng tob
kai werden mit Händeklappen begleitet, die Phleng heh im
vollen Chor gesungen. Verschieden sind die Phleng Chakka-
rava, und je nach dem gepriesenen Gegenstände kennt man Phleng
Majtira (Pfauenlieder), Phleng Hera (Delphinenlieder), Phleng
Nok Krathung, Phleng Nok Jang u. s. w. In den Schifferliedern
(Phleng Rüa) antworten alle Ruderer im Takte dem Vorsänger.
Die Phleng chak sind Wehmuthslieder über Abschied und
Trennung.
Wenn sich keine Vorschriften über Accente finden, heissen
die Verse khlong, wogegen sich in den Sala-luen genannten
solche niedergelegt finden. Mit dem declamatorischen Element
der christlichen Dichter (im 4ten Jahrhundert p. d.) tritt das
Vorwalten des Accentes über die Quantitäi auf, und in den
versificirten Fabeln der Byzantiner wird die Quantität mehr
und mehr durch den Accent verdrängt.
In den Nongsü-Rong oder Gesangbüchern, zu denen die
meisten Lakhon gehören, bilden zwei Thon einen Kham. In
jeder Linie finden sich 7, 8 oder 10 Silben/ ohne Rücksicht*)
auf Kürze oder Länge (Krahu, Lahu), wie sie in den Paliversen
beachtet werden. Für die Abwechslung der hohen und niederen
Accente gelten bestimmte Gesetze der Stellung, zu deren Erläuterung
in den Lehrbüchern Schemata beigefügt sind. Hin*)
Nach Weil und Benloew war die antike Betonungsweise wesentlich musikalisch.
Zu Servius’ Zeit unterschied man nicht mehr lange und kurze, sondern
nur hochbetonte und tiefbetonte. Silben. In der volksthümlich-christlichen Dichtung
der letzten Zeiten des römischen Kaiserreichs bildete sich das accentuirende
Princip der Verskunst aus, das dann auf die romanischen Sprachen überging
(s. Coxssen).