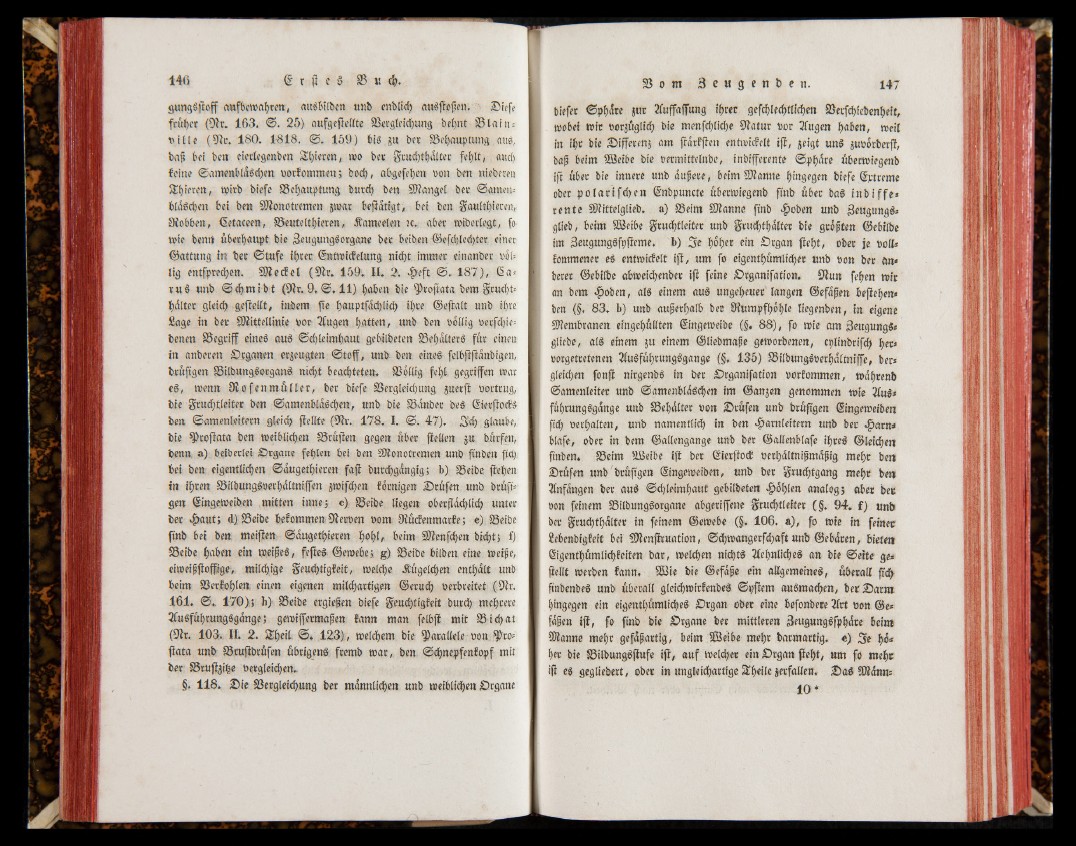
gungSftoff aufbc wahren, auSbilbcn unb entließ auSftofen. Sief?
früher (9kr. 163. @. 25) aufgeffettte 33ecg(eid)ung befnt S31 a i n =
» ille (Sttc. 180. 1818. © . 1 5 9 ) bis ju ber SSehauptung aue,
baf bei ben eierlegcnben Spieren,: wo bet gruchthdltec fehlt, and)
feine ©amenbldSd)en »otkontme«} bod), abgefehett von ben mebemi
Slneren, wirb biefe ^Behauptung butd) ben Mangel ber ©amen*
bldSchen bei ben Sftonotremen jwat betätigt, bei ben gaultl)ieren,
SSobben, ©etaceen, {Beuteltieren, Äameelen tc, aber reib erlegt, fo
wie benrt überhaupt bie Beugungsorgane bec beiben ©efd)led)ter einet
©attung in bec ©tufe ihrer ©ntwickelung nid)t immer einanber »ot=
lig entfpvedjen. SJteckel (9 tr, 159; II. 2. «Heft © . 1 8 7 ), ©a*
r uS unb © c l)m ib t (9tr, 9. © . 11) haben bie ^roftata. bem grud)t*
haltet gleich geftettt, inbem fte f>auptfdd>tid> ihre ©eftalt «nb ihre
ßage in bec SKittetlinie vor klugen hatten, unb ben völlig »erfdjic*
benen SSegciff eines aus ©d)leimf)aut gebtlbeten Schalters für eine«
in anberen Organen erzeugten © toff, unb ben eines felbfiftanbigen,
brüftgen SSilbttngSocganS nid)t beachteten. {Bbtttg fehl gegriffen war
eS, wenn 9 J o f e n m u lte r, ber biefe 23ergleid)ung p erft »orteug,
bie grudhtleiter ben ©amenblaSchen, unb bie SSanbec beS ©ierftoclS
ben Samenleitern gleich {bellte (9ir. 178. I. ©. 47). 3d) glaube,
bie ^»coftata ben weiblichen SSrüfien gegen über {betten ju dürfen,
benn a) beibetlet, Organe fehlen bei ben fDbonotremen unb ftnben fid>
bei ben eigentlichen ©augethieren fa{b burchgangig; b) Selbe {behen
in ihren SSilbungSnerhaltniffen jwifchen körnigen Orüfen unb brufn
gen ©ingeweiben mitten time; c) SSeibe liegen oberflächlich unter
ber «Haut; d)J8eibe befommen Sternen »om 9tückenmarke; e) SSeibe
ftnb bei ben meiftem ©augethieren h ° i / beim 2Äenfd)en bid)t; f)
Seibe höben ein W.eifeS, fejbeS ©ewebe; g) SSetbe bilben eine weife,
eiweifftoffige, milchige geud)tigfeit, welche Äugelchen enthalt unb
beim Seekohlen einen eigenen milchartigen ©eruch »erbreitet (9br.
161. ©* 170)5 h) SSeibe ergiefen biefe geudjtigfeit burch mehrere
2fuSfuhrungSgdnge; gewiffermafen kann man felb{b mit 33ich«t
(9br. 1 0 3 . II. 2 . Sheil © . 123),, welchem bie {Parallele »on $)to=
{bata unb Stufibrüfen übrigens feemb war, ben ©dhnepfenfopf mit
ber { S tu f te »ergleichen.
§. 118. Oie {öergleid)ung ber mdnnlidjen unb weiblichen Organe
biefec ©phdre jur 2fuffaffung ihrer gefchlechflichen Serfchtebenheif,
wobei wir »orjüglich bie menfchlidje 9?atur »or Sugen höben, weil
in ihr bie Oifferenj am fbdrfjben entwickelt i{b, jeigt uns $u»drberft,
baf beim Söeibe bie »ermitfelnbe, inbifferente ©phace übeewiegenb
ift über bie innere unb duftere, beim Spanne hingegen biefe ©ptreme
ober p o la r if d je n ©nbpuncte rtberwiegenb ft'nb über baS in b iffe #
re n te Söbittelglieb. a) Seim Spanne ft'nb «Hoben unb BeugungS*
glteb, beim SBeibe gruchtleitec unb grudfthaltec bie groften ©ebilbe
im 3e«gungSfp{feme. b) 3 e hoher «in S rgan fleht, ober je »oll*
fommener eS entwickelt ifi, um fo eigentümlicher unb »on ber an*
betet ©ebilbe abweidhmber ift feine Organifation. 9t«u fehen wir
an bem «ffoben, als einem aus ungeheuer langen ©efafen beffehen*
ben (§. 83, b) unb auferhalb ber Stumpfhbhle liegenben, in eigene
Membranen eingehüttten ßingeweibe (§, 8 8 ), fo wie am BeugungS«
gliche, als einem ju einem ©liebmafe geworbenen, cplinbrifd) fym
oorgetretenen 3fuSfuhrungSgange (§. 135) SSilbungSoerhaltniffe, ber*
gleichen fonft nirgenbS in ber Organifation »orkommett, wdhrenb
©amenleiter unb ©amenbldSchen im ©anjen genommen wie 2fuS*
führungSgdnge unb SSehdlter »on Orüfen unb brüftgen ßingeweiben
ftch »erhalten, unb namentlich in ben «Harnleitern unb ber «Ham*
blafe, ober in bem ©attengange unb ber ©attenblafe ihres ©leichet»
ftnben* SSeim SBeibe ift ber ©ierftock »erhaltnifmafig mehr be»
Orüfen unb brüftgen ©ingeweibe«, unb ber grudjtgang mehr be»
Anfängen ber auS ©chteimhaut gebilbeten «Höhlen analog} aber ber
»on feinem SSilbungSorgane abgeriffene gruchtleiter (§. 94. f) unb
ber grudhthdlter in feinem ©ewebe (§. 106. a ), fo wie in feiner
2ebenbigfeit bei Sltenftruation, @d)Wangetfd)aft unb ©ebdren, bieten
©igenthümlichkeiten bar, welchen nichts Sehnliches an bie ©efte ge*
{teilt werben kann, 5Bie bie ©efdfe ein allgemeines, überall ftdE>
ftnbenbeS unb überall gleichwirkenbeS ©pftem ausmachen, b erO arm
hingegen ein eigenthümltcheS Organ ober etne befonbere S rt »on ©e*
fdfen ift, fo ftnb bie Organe ber mittleren BeupngSfphdre beim
Spanne mehr gefdfartig, beim SBeibe mehr barmartig. «) S e h»s
her bie §3ilbungSfiufe ift, auf welcher ein Organ fleht/ um fo mehr
ift eS gegltebert, ober in ungleichartige Shetle verfallen. OaS SOtann*