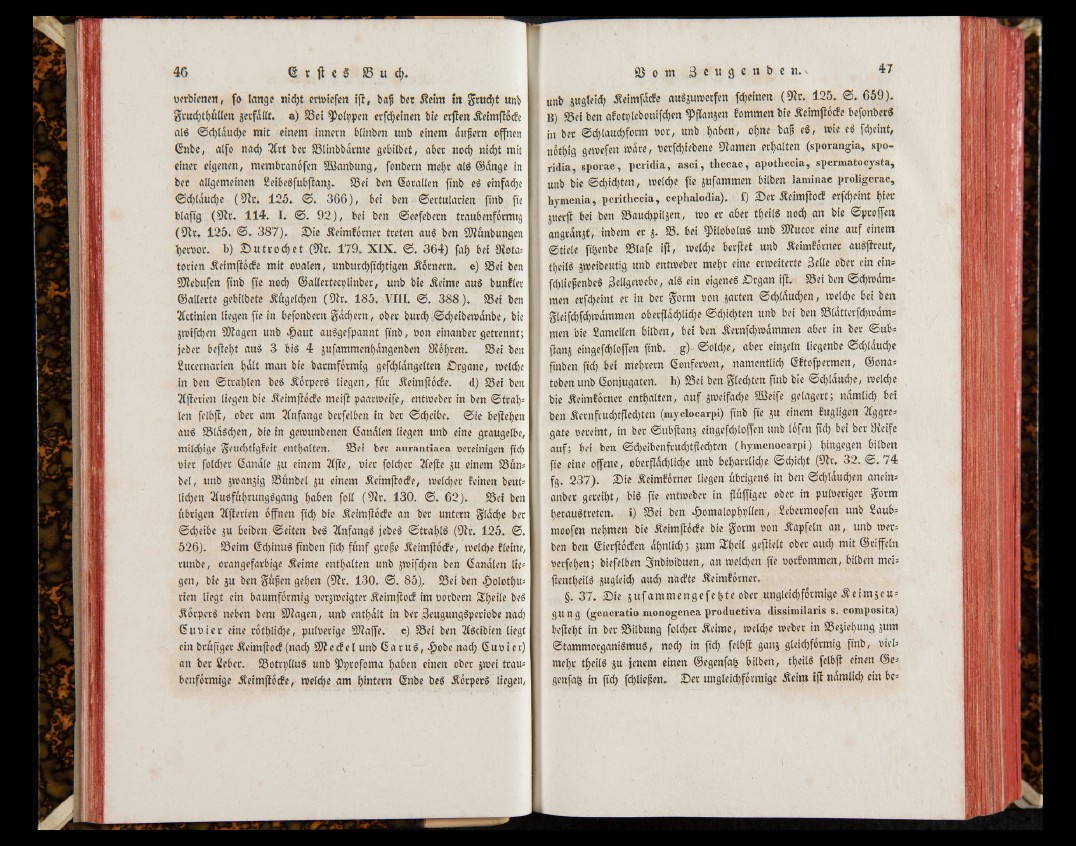
46 © r ft e S 83 u cf).
verbienen, fo lange nicht etwiefen tjî, baft bec Äetm in $?rud)t «nb
grud)tt)ôllen ierfallt. a) SSet ^olppen erfeheinen bi,e erfïen Âeimjïode
alS ©d)ldud)e mit einem tnnern blinben unb einem dttfern offnen
©nbe, alfo nach 3frt bec SSlinbbdcme gebilb'et, abec nod) nid)t mit
einet eigenen, membranofen SBanbung, fonbeen mef>t alS ©ange in
bec allgemeinen SeibeSfubfianj. SSei ben (üotallen ftnb eS einfache
©chlaudje (9 tc. 125* © . 3 6 6 ), bei ben ©ertularien ftnb fte
blaftg (9 fr. 114. I. © . 9 2 ) , bei ben ©eefebern traubenfôrmtg
(9 tr. 125. ©* 3 8 7 ). S ie Äeintfbrnet treten aus ben SJîûnbungen
hervor, b) S u t r o c h e t (9fc. 179, X IX . © . 364) fai) bei 9îota=
tocien ÂeimflôÆe mit ovalen, unburchftchtigen Âocnetn. e) SSei ben
SOfebufen ftnb fie nod) ©allertecplinber, «nb bie iîeime auS bunfler
©alterte gebilbete Äugelten (9fr. 185. VIII. © . 388 ). SSei ben
2fctinien liegen fie in befonbeen Samern, ober bucch.Scheibewdnbe, bie
jroifdjen 9)fcagen «nb ^ a « t auSgefpannt ftnb, non einanber getrennt;
jebec befielt auS 3 bis 4 jufammenfjdngenben Sïohren, SSei ben
Sucernarien halt man bie barmfdrmig gefd)ldngetten Stgdne, welche
in ben © tragen beS iïôrperS liegen, fût jfceimfïbde, d) SSei ben
2ljïeriett liegen bie dîeimfiode nteiffc paarweife, entweber in ben ©tcah*
(en felbft, ober am Anfänge berfelben in bec ©djeibe. ©ie befielen
auS SSlaSdjen, bie in gewunbenen OEattdlen liegen «nb eine gcaugelbe,
milchige 8eucl)tig?eit enthalten. SSei bec aurantiaca vereinigen fiel)
nier folchec (Sandle ju einem 2ljïe, nier folchec 2fefîe 5« einem SSûn*
bel, «ttb jtnanjig SSunbel $u einem Äeimffcocfe, welcher feinen beut*
liefen fluSfûhtungSgang haben foU (9fr. 130. © . 6 2 ), S3ei ben
übrigen Tffïerien offnen ftd) bie jfceimffôde an ber «ntern ^Iddfje ber
©djeibe jtt beiben ©eiten beS flnfangS jebeS ©trahis (9fr. 125. ©,
526). SSeim ©d)inuS ft'nben fiel) fünf große ÂeimfîoÆe, weldje fleine,
runbe, orangefarbige Äeime enthalten «nb jwifehen ben ©analen lie*
gen, bie ju ben 3«jjen gehen (9fc. 130. © . 85), SSei ben .folothu*
rien liegt ein baumformig verjweigter jfceimffcod im norbern Steile be$
ÄorpetS neben bent SÖfagen, «nb enthalt in ber 3eugungSpetiobe nad)
© « v i e r eine rotbliche, pulverige Sfaffe, c) SSei ben flsdbien liegt
ein bruftger Äeimfiocf (nach 50Î e d e l «nb © a r u S , «£)obc nach © u v i e r)
an ber 2eber. SSotcplluS «nb 9>profoma haben einen ober jwei trau*
benfdrmige Äeimffcode, welche am hintern ©nbe beS iîorperS liegen,
SS 0 m 3 c « 9 c n 6 e n * ' 4 7
«nb jugteid) Äeimfdde auSjuwerfen fe in e n (9 fr. 125. © . 6 5 9 ).
B) SSei ben afotplebonifdjen spflanjen fommen bie Äeimftode befonberS
in ber ©d)laucbform vor, «nb haben, ohne bajj eS, wie ei fd)eint,
nothig getoefen wäre, verfd)iebene 9famen erhalten (sporangia, spo-
ridia, sporae, peridia, asci, thecac, apothecia, spcrmatocysta,
«nb bie ©d)id)ten, welche fie jufammen bilben laminae proligerae,
liymenia, perithecia, cephalodia), f) S ec Äeimftod erfd)eint hie«
juerfl bei ben SSaud)pil&en, wo er aber theil« noch an bie ©proffen
angrdn^t, inbem er §. S3. bei ^iloboluS «nb 9)f«coc eine auf einem
©tiele fifcenbe S5lafe ifi, welche berftet «nb Äeimfocner augflreut,
ttjeilö jweibeutig «nb ent web er mehr eine erweiterte Belle ober ein ein*
fd)liefjenbe§ BeÜgewebe, alö ein eigenes £>rgan ifi. SSei ben ©djwdm*
men erfd)eint er in ber §orm non garten ©chldudjen, welche bei ben
gleifchfchwdmmen oberflächliche ©dachten «nb bei ben SSlatterfchwdm*
men ‘oie gamellen bilben, bei ben Äernfdjwdmmen aber in ber ©ub=
flanj eingefdjloffen ftnb. g)- ©old>e, abec einzeln liegenbe ©chlauche
ftnben ftd) bei mel)rern ßonfernen, namentlich ©ftofpermen, ©ona*
toben unb (Sonjugaten. h) SSei ben g leiten ftnb bie ©d)la«d)e, weld>e
bie Äeimforner enthalten, auf gweifadje SBeife gelagert; ndmlidh bet
ben Äernfcuchtflechten (myelocarpi) ftnb fie 5« einem fugligen flggre*
gate vereint, in ber ©ubftanj eingefchloffen unb lofen ftch bei ber 3feife
auf; bei ben ©d)eibenfr«d)tfled)ten (hymenocarpi) hingegen bilben
fie eine offene, oberflächliche «nb beharrliche ©d)id)t (5fr, 32. © . 7 4
fg. 2 3 7 ). ©ie Äeimforner liegen übrigens in ben ©d)ldud)en anein*
anber gereiht, bis fie entwebec in fluffigec ober in pulveriger $orm
herauStreten. i) SSei ben #omalophpUen, Sebermoofen «nb £aub=
moofen nehmen bie Äeimffbde bie Sorm von Äapfeln an, «nb wer*
ben ben ©ierfioefen ähnlich; 5«m ^ h ^ i m m ober auch mit ©riffeln
verfehen; biefelben Snbivibuen, an welchen fte vorfommen, bilben mci*
ftentheilS jugleid) auch nddte Äeimforner.
§. 37. S ie j u f am m e t t g e f e h t e ober ungleichförmige ^ e i r n j e u *
gttng (generatio monogenea productiva dissimilaris s. composita)
befteht in ber SSitbung fold)ec Äeime, welche webec in SSejiehttng jum
©tammocganiSmuS, nod) in ftd) felbffc ganj gleichförmig ftnb, viel*
mehr theilS ju jenem einen ©egenfa^ bilben, theilS felbffc einen ©e*
genfafc in ftch fchliefjen. S e r ungleichförmige Äeim iffc namlid) ein be*