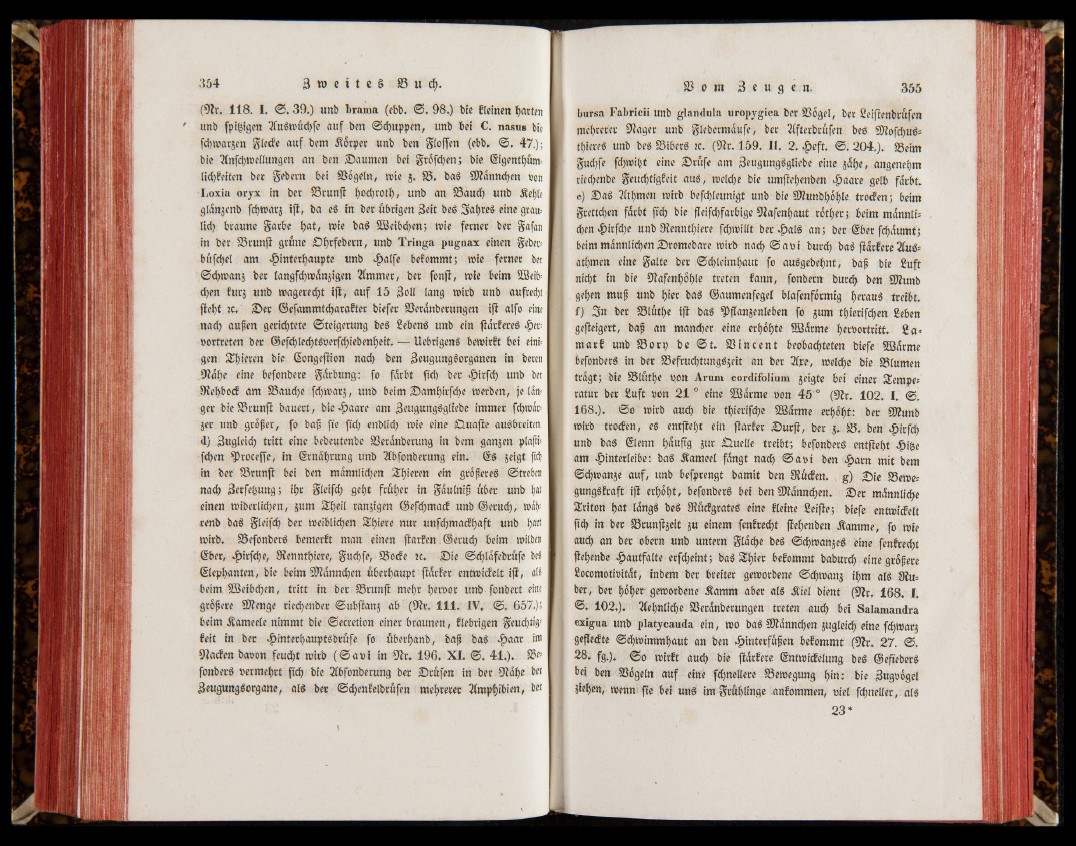
(9tr. 118. I. © .3 9 .) unb brama (ebb. © .9 8 .) bie fteilten garten
' unb fpiijigen ‘tfugwücbfe auf ben ©cbttppen, unb bei C. nasus bie
fcbwarjen gtecfe auf bem Horper unb ben Stoffen (ebb. © . 47.);
bie 2[nfd)WelIungen an ben Säum en bei S to ffen ; bie ©igentbünv
liebfeiten ber gebern bei SSogeln, wie j. SS. bag 9Ädnnd)en tion
Loxia oryx in bet SStunft |otbr©f|* unb an SSauct) unb Heble
gldn^cnb fdi)tt>acj ifi, ba eg in bet übrigen Seit beg Sabteg eine gtau--
lid) braune gatbe bat/ wie bag SBeibd)en; wie ferner ber gafan
in ber SSrunft grüne Sbrfebern, unb Tringa pugnax einen geber>
büfebet am »^interbaupte unb «hälfe befommt; wie ferner bet
©cbwanj ber langfebwanjigen 2Cmmer, ber fonfb, wie beim SSeib=
eben fürs unb wägetest ifi; auf 15 Soll tang wirb unb aufrecht
ftebt ic. S e t ©efammtebarafter biefet SSerdnberungen ifi alfo eine
na et) aufen gerichtete ©teigerung beg Sebeng unb ein ftdrfereg
tiortreten ber ©efcblecbfStietfd)iebenbeif.— Uebtigeng bewirft bei eini=
gen Sbieren bie ©ongeftion nach ben Seugunggorganen in beten
% tb e eine befonbere Narbung: fo färbt ftd) ber «hirfd) unb ä®
9?ebbo<J am SSaucbe fdjwarj, unb beim Sambirfd)e werben, je lifo
ger bieS3runft bauert, bte «haare am Seugungggliebe immer fcbwfo
jer unb großer, fo baß fie fiel) enblicb wie eine Sluafte augbreiten.
d) Sugleicb tritt eine bebeutenbe SSeranberung in bem ganzen ptafii=
fd)en ptoceffe, in ©rndbtung unb Tlbfonberung ein. ©g geigt ftd)
in ber SSrunft bei ben mdnn(ict)en Sbieren ein gtoßereg ©tceben
nach Setfe&ung; ibt gleifd) gebt früher in gdulntß über unb fat
einen wiberltcben, jum Sbeil ranzigen ©efebmaef unb ©erueb, wdf);
renb bag gleifd) ber weiblichen Spiere nur unfebmaefbaft unb bflrt
wirb. SSefonberg bemerft man einen ftarfen. ©erueb beim wilben
©ber, «hirfdje, SJehntbiere, gud)fe, SSocfe ic. S ie ©d)Idfebrüfe p#
©lepbanten, bie beim 3JMnnd)en überhaupt fidefer entwicfelt iji, alf
beim 2Beibd)en, tritt in bet SSrunft mehr betoor unbfonbert eine
größere Stenge rieebenber ©ubftanj ab (Sfa. 111. IV. © . 657.);
beim Hameele nimmt bie ©ecretion einer braunen, fiebrigen geud)tt0;
feit in ber «hinterbauptgbrüfe fo überbanb, baß bag «haar int
9?atfen baoon feucht wirb (@a o t in 9lr. 196. X I. © . 41.). SSp
fonberg oermebrt fteb bie 2fbfonberung ber S rüfen in ber ^ab e bet
Seugunggorgane, alg ber ©cbenfelbrüfen mehrerer Amphibien, bet
bursa Fabricii unb glandula uropygica ber 23ogel, bet Seiftenbrüfen
mehrerer 9?ager unb gtebermaufe, ber 2Cfterbrüfen beg 2)?ofd)Ug=
tbiereg unb beg SSiberg k. (9?r. 159. II. 2. «heft. © . 204.). SSeim
gud)fe fd>wibt eine Srüfe am Seugungggliebe eine jdbe, angenehm
ried;enbe geuebtigfeit aug, weld)e bie umfiebenben «haare gelb färbt.
e) S ag 2ftbmen wirb befcbleunigt unb bie SDZunbboble troefen; beim
grettdjen färbt ftd) bie fleifcbfarbige 9?afenbaut rotber; beim mannte
d)en^irfd)e unb Sfenntbiere fcbwillt ber «halg an; ber ©berfebdumt;
beim männlichen Sromebare wirb n a c b©a » i burd) bag ftdrfere 2fuö=
atbmen eine gälte ber ©djleimbaut fo auggebebnt, baß bie Suft
nicht in bie Sfafenboble treten fann, fonbern burd) ben 2Äunb
geben muß unb hier bag ©aumenfeget blafenformig beraug treibt.
f) S n ber SSlütbe ift bag Pflan^enleben fo $um tbierifeben geben
gefteigert, baß an mand)er eine erhöhte 5ödrme bertiortritt. 2a«
t n a r f unb SSotp be © t . S 3 i n c e n t beobachteten biefe SBdrme
befonberg in ber S3eftucbtungg$eit an ber 2Cre, welche bie SSlumen
tragt; bie SSlütbe pon Arum cordifolium geigte bei einer 2empe=
ratur ber Suft tion 21 ° eine Sßdrme »on 4 5 ° (9?r. 102. I. © .
168.). ©o wirb auch bie tbierifd)e 2Bdrme erhobt: ber SWunb
wirb troefen, eg entjfebt ein fiarfet S u rft, ber j. 25. ben vfjirfd)
unb bag ©lenn häufig jur Quelle treibt; befonberg entflebt £i%e
am ^interleibe: bag Äameel fangt nadb © a tii ben cfjattt mit bem
©djwanje auf, unb befprengt bamit ben Oiücfen. g) S ie SSewe^
gunggfraft ifi erhobt, befonberg bei ben Männchen. S e r männliche
Sriton bat langg beg 9lücfgrafeg eine fleine Seifte; biefe entwicfelt
ftd) in ber SSrunfijeit ju einem fenfreebt ftebenben Hamme, fo wie
auch an ber obern unb untern gldcbe beg ©cbwanjeg eine fenfredbt
ftebenbe ^autfalte erfd)eint; bag Sbiet befommt babureb eine größere
Socomotioitdt, inbem bet breiter geworbene ©cbwanj ihm alg 9?us
ber, bet bof>cc geworbene Hamm aber alg Hiel bient (9fo. 168. I.
© . 102.). Tfebnlicbe S3erdnberungen treten auch bei Salamandra
exigua unb platycauda ein, wo bag 9)tdnnd)ett zugleich eine febwarj
geflecfte ©dbwimmbaut an ben dMnterfüfen befommt (9lr. 27. © .
28. fg.). @o wirft aud) bie ftdrfere ©ntwiifelung beg ©efteberg
tei. ben S3oge(n auf eine fcbneltere SSewegung bin: bie 3ugtiogel
Stehen, wenn fte bei ung imgrfibtinge anfommen, w'el fcbneller, alg