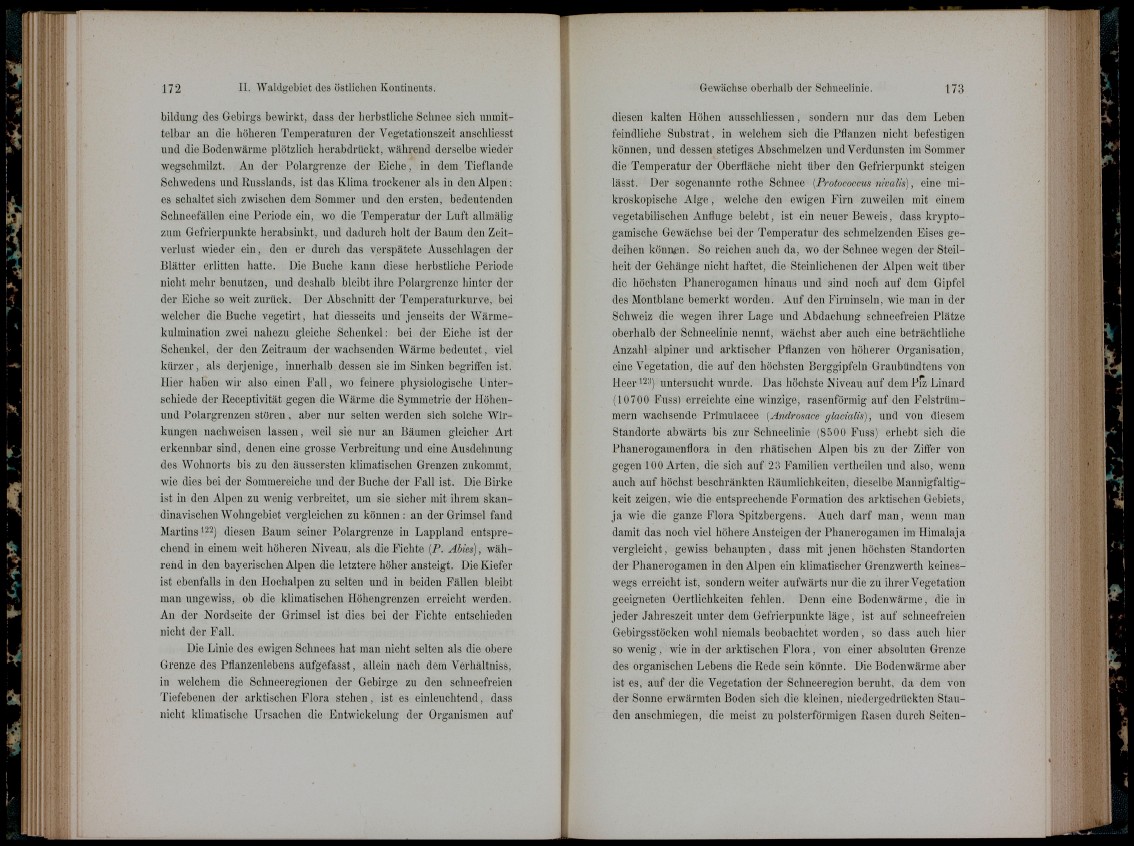
. .li
172 IL Waldgebict des östliclien Kontinents. Gewächse oberhalb der Schneelinie. 173
./i
) • • }
i »
^ i
bildmig des Gebirgs bewirkt, dass der herbstliche Schnee sich unmittelbar
au die höheren Temperaturen der Vegetationszeit anschliesst
und die Bodenwärme plötzlich herabdrückt, während derselbe wieder
wegschmilzt. An der Polargrenze der Eiche, in dem Tieflande
Schwedens und Kusslands, ist das Klima trockener als in den Alpen;
es schaltet sich zwischen dem Sommer und den ersten, bedeutenden
Schneefällen eine Periode ein, wo die Temperatur der Luft allmälig
zum Gefrierpunkte herabsinkt, und dadurch holt der Baum den Zeitverlust
wieder ein, den er durch das verspätete Ausschlagen der
Blätter erlitten hatte. Die Buche kann diese herbstliche Periode
nicht mehr benutzen, und deshalb bleibt ihre Polargrenze liinter der
der Eiche so weit zurück. Der Abschnitt der Temperaturkurve, bei
welcher die Buche vegetirt, hat diesseits und jenseits der Wärmekulmination
zwei nahezu gleiche Schenkel: bei der Eiche ist der
Schenkel, der den Zeitraum der wachsenden Wärme bedeutet, viel
kürzer, als derjenige, innerhalb dessen sie im Sinken begriffen ist.
liier haben wir also einen Fall, wo feinere physiologische Unterschiede
der Receptivität gegen die Wärme die Symmetrie der Hölienund
Polargrenzen stören, aber nur selten werden sich solche Wirkungen
nachweisen lassen, weil sie nur an Bäumen gleicher Art
erkennbar sind, denen eine grosse Verbreitung und eine Ausdehnung
des Wohnorts bis zu den äussersten klimatischen Grenzen zukommt,
wie dies bei der Sommereiche und der Buche der Fall ist. Die Birke
ist in den Alpen zu wenig verbreitet, um sie sicher mit ihrem skandinavischen
Wohngebiet vergleichen zu können : an der Grimsel fand
Martins diesen Baum seiner Polargrenze in Lappland entsprechend
in einem weit höheren Niveau, als die Fichte (P. ^dws)^ während
in den bayerischen Alpen die letztere höher ansteigt. Die Kiefer
ist ebenfalls in den Hochalpen zu selten und in beiden Fällen bleibt
man ungewiss, ob die klimatischen Höhengrenzen erreicht werden.
An der Nordseite der Grimsel ist dies bei der Fichte entschieden
nicht der Fall.
Die Linie des ewigen Schnees hat man nicht selten als die obere
Grenze des Pflanzenlebens aufgefasst, allein nach dem Verhältniss,
in welchem die Schneeregionen der Gebirge zu den schneefreien
Tiefebenen der arktischen Flora stehen, ist es einleuchtend, dass
nicht klimatische Ursachen die Entwickelung der Organismen auf
diesen kalten Höhen ausschliessen, sondern nur das dem Leben
feindliche Substrat, in welchem sich die Pflanzen nicht befestigen
können, und dessen stetiges Abschmelzen und Verdunsten im Sommer
die Temperatur der Oberfläche nicht über den Gefrierpunkt steigen
lässt. Der sogenannte rothe Schnee [Protococcus nivalis), eine mikroskopische
Alge, welche den ewigen Firn zuweilen mit einem
vegetabilischen Anfluge belebt, ist ein neuer Beweis, dass kryptogamische
Gewächse bei der Temperatur des schmelzenden Eises gedeihen
könn^i^n. So reichen auch da, wo der Schnee wegen der Steilheit
der Gehänge nicht haftet, die Steinlichenen der Alpen weit über
die höchsten Phanerogamen hinaus und sind noch auf dem Gipfel
des Montblanc bemerkt worden. Auf den Firninseln, wie man in der
Schweiz die wegen ihrer Lage und Abdachung schneefreien Plätze
oberhalb der Schneelinie nennt, wächst aber auch eine beträchtliche
Anzahl alpiner und arktischer Pflanzen von höherer Organisation,
eine Vegetation, die auf den höchsten Berggipfeln Graubündtens von
Heer untersucht wurde. Das höchste Niveau auf dem Piz Linard
(10700 Fuss) erreichte eine winzige, rasenförmig auf den Felstrümmern
wachsende Primulacee [Ajidrosace glacialis)^ und von diesem
Standorte abwärts bis zur Schneelinie (8500 Fuss) erhebt sich die
Phanerogamenflora in den rhätischen Alpen bis zu der Ziffer von
gegen 100 Arten, die sich auf 23 Familien vertheilen und also, wenn
auch auf höchst beschränkten Räumlichkeiten, dieselbe Mannigfaltigkeit
zeigen, wie die entsprechende Formation des arktischen Gebiets,
j a wie die ganze Flora Spitzbergens. Auch darf man, wenn man
damit das noch viel höhere Ansteigen der Phanerogamen im Himalaja
vergleicht, gewiss behaupten, dass mit jenen höchsten Standorten
der Phanerogamen in den Alpen ein klimatischer Grenzwerth keineswegs
erreicht ist, sondern weiter aufwärts nur die zu ihrer Vegetation
geeigneten Oertlichkeiten fehlen. Denn eine Bodenwärme, die in
jeder Jahreszeit unter dem Gefrierpunkte läge, ist auf schneefreien
Gebirgsstöcken wohl niemals beobachtet worden, so dass auch hier
so wenig, wie in der arktischen Flora, von einer absoluten Grenze
des organischen Lebens die Rede sein könnte. Die Bodenwärme aber
ist es, auf der die Vegetation der Schneeregion beruht, da dem von
der Sonne erwärmten Boden sich die kleinen, niedergedrückten Stauden
anschmiegen, die meist zu polsterförmigen Rasen durch Seiten