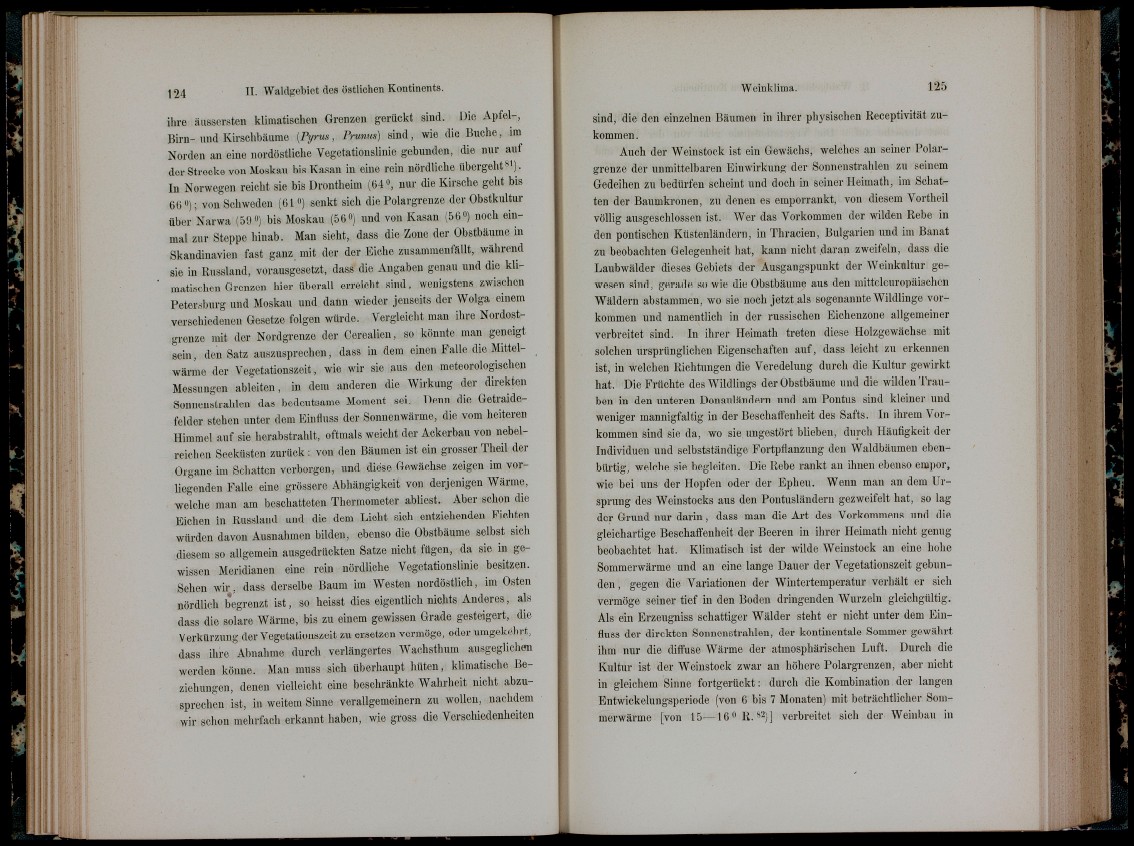
! 1
1 ':
•J ••
r •
iij-'S r
j » \i
124 II. Waldgebiet des östlichen Kontinents
ihre äiissersten klimatischen Grenzen gerückt sind. Die Apfel-,
Birn- und Kirschbäume {Bjrus, Prunus) sind, wie die Buche, im
Norden an eine nordöstliche Vegetationslinie gebunden, die nur auf
der Strecke von Moskau bis Kasan in eine rein nördliche übergeht 8i).
In Norwegen reicht sie bis Drontheim ( 6 4 n u r die Kirsche geht bis
66»); von Schweden ( 6 1 s e n k t sich die Polargrenze der Obstkultur
über Narwa (59") bis Moskau (56o) und von Kasan (56O) noch einmal
zur Steppe hinab. Man sieht, dass die Zone der Obstbäume in
Skandinavien fast ganz, mit der der Eiche zusammenfällt, während
sie in Russland, vorausgesetzt, dass die Angaben genau und die klimatischen
Grenzen hier überall erreicht sind, wenigstens zwischen
Petersburg und Moskau und dann wieder jenseits der Wolga einem
verschiedenen Gesetze folgen würde. Vergleicht man ihre Nordostgrenze
mit der Nordgrenze der Cerealien, so könnte man geneigt
sein, den Satz auszusprechen, dass in dem einen Falle die Mittelwärme
der Vegetationszeit, wie wir sie aus den meteorologischen
Messungen ableiten, in dem anderen die Wirkung der direkten
Sonnenstrahlen das bedeutsame Moment sei. Denn die Getraidefelder
stehen unter dem Einfluss der Sonnenwärme, die vom heiteren
Himmel auf sie herabstrahlt, oftmals weicht der Ackerbau von nebelreichen
Seeküsten zurück : von den Bäumen ist ein grosser Theil der
Organe im Schatten verborgen, und diese Gewächse zeigen im vorliegenden
Falle eine grössere Abhängigkeit von derjenigen Wärme,
welche man am beschatteten Thermometer abliest. Aber schon die
Eichen in Russland und die dem Licht sich entziehenden Fichten
würden davon Ausnahmen bilden, ebenso die Obstbäume selbst sich
diesem so allgemein ausgedrückten Satze nicht fügen, da sie in gewissen
Meridianen eine rein nördliche Vegetationslinie besitzen.
Sehen wir, dass derselbe Baum im Westen nordöstlich, im Osten
nördlich begrenzt ist, so heisst dies eigentüch nichts Anderes, als
dass die solare Wärme, bis zu einem gewissen Grade gesteigert, die
Verkürzung der Vegetationszeit zu ersetzen vermöge, oder umgekehrt,
dass ihre Abnahme durch verlängertes Wachsthum ausgeglichen
werden könne. Man muss sich überhaupt hüten, klimatische Beziehungen,
denen vielleicht eine beschränkte Wahrheit nicht abzusprechen
ist, in weitem Sinne verallgemeinern zu wollen, nachdem
wir schon mehrfach erkannt haben, wie gross die Verschiedenheiten
Weinklima. 125
sind, die den einzelnen Bäumen in ihrer physischen Receptivität zukommen
.
Auch der Weinstock ist ein Gewächs, welches an seiner Polargrenze
der unmittelbaren Einwirkung der Sonnenstrahlen zu seinem
Gedeihen zu bedürfen scheint und doch in seiner Heimath, im Schatten
der Baumkronen, zu denen es emporrankt, von diesem Vortheil
völlig ausgeschlossen ist. Wer das Vorkommen der wilden Rebe in
den pontischen Küstenländern, in Thracien, Bulgarien und im Banat
zu beobachten Gelegenheit hat, kann nicht .daran zweifeln, dass die
Laubwälder dieses Gebiets der Ausgangspunkt der Weinkultur gewesen
sind, gerade so wie die Obstbäume aus den mitteleuropäischen
Wäldern abstammen, wo sie noch jetzt als sogenannte Wildlinge vorkommen
und namentlich in der russischen Eichenzone allgemeiner
verbreitet sind. In ihrer Heimath treten diese Holzgewächse mit
solchen ursprünglichen Eigenschaften auf, dass leicht zu erkennen
ist, in welchen Richtungen die Veredelung durch die Kultur gewirkt
hat. Die Früchte des Wildlings der Obstbäume und die wilden Trauben
in den unteren Donauländern und am Pontus sind kleiner und
weniger mannigfaltig in der BeschaflPenheit des Safts. In ihrem Vorkommen
sind sie da, wo sie, ungestört blieben, durch Häufigkeit der
Individuen und selbstständige Fortpflanzung den Waldbäumen ebenbürtig,
welche sie begleiten. Die Rebe rankt an ihnen ebenso empor,
wie bei uns der Hopfen oder der Epheu. Wenn man an dem Ursprung
des Weinstocks aus den Pontusländern gezweifelt hat, so lag
der Grund nur darin, dass man die Art des Vorkommens und die
gleichartige Beschaffenheit der Beeren in ihrer Heimath nicht genug
beobachtet hat. Klimatisch ist der wilde Weinstock an eine hohe
Sommerwärme und an eine lange Dauer der Vegetationszeit gebunden,
gegen die Variationen der Wintertemperatur verhält er sich
vermöge seiner tief in den Boden dringenden Wurzeln gleichgültig.
Als ein Erzeugniss schattiger Wälder steht er nicht unter dem Einfluss
der direkten Sonnenstrahlen, der kontinentale Sommer gewährt
ihm nur die diffuse Wärme der atmosphärischen Luft. Durch die
Kultur ist der Weinstock zwar an höhere Polargrenzen, aber nicht
in gleichem Sinne fortgerückt: durch die Kombination der langen
Entwickelungsperiode (von 6 bis 7 Monaten) mit beträchtlicher Sommerwärme
[von 15—16 0 R. 82)] verbreitet sich der Weinbau in
\