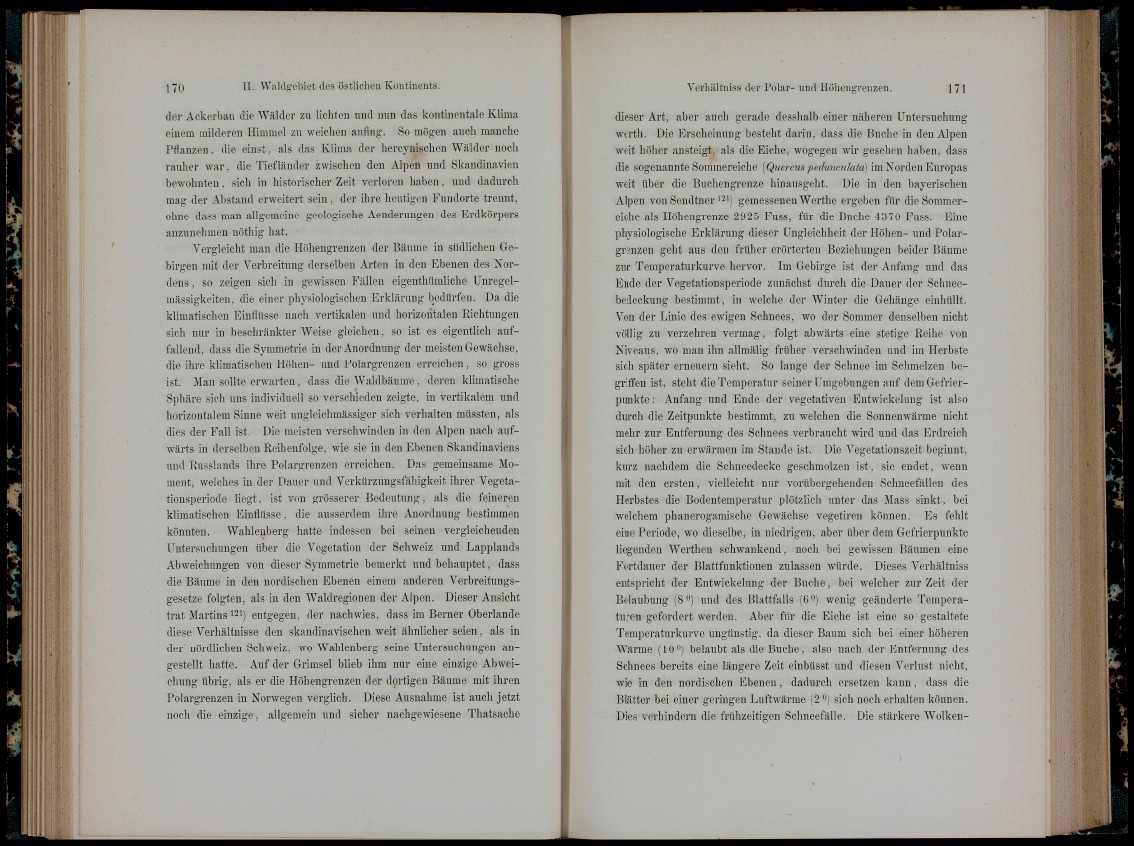
iiinil^^
•••ih- I •!. ! i-'-v
I •
i J . •
t
i i
If n,
170 IL Waldgebiet des östlichen Kontinents.
der Ackerbau die Wälder zn lichten nnd nun das kontinentale Klima
einem milderen Himmel zu weichen anfing. So mögen auch manche
Pflanzen, die einst, als das Klima der hercynischen Wälder noch
rauher war, die Tiefländer zwischen den Alpen und Skandinavien
bewohnten, sich in historischer Zeit verloren haben, und dadurch
mag der Abstand erweitert sein, der ihre heutigen Fundorte trennt,
ohne dass man allgemeine geologische Aenderungen des Erdkörpers
anzunehmen nöthig hat.
Vergleicht man die Höhengrenzen der Bäume in südlichen Gebirgen
mit der Verbreitung derselben Arten in den Ebenen des Nordens
, so zeigen sich in gewissen Fällen eigenthümliche Unregelmässigkeiten,
die einer physiologischen Erklärung bedürfen. Da die
klimatischen Einflüsse nach vertikalen und horizontalen Richtungen
sich nur in beschränkter Weise gleichen, so ist es eigentlich auffallend,
dass die Symmetrie in der Anordnung der meisten Gewächse,
die ihre klimatischen Höhen- und Polargrenzen erreichen, so gross
ist. Man sollte erwarten, dass die Waldbäume, deren klimatische
Sphäre sich uns individuell so verschieden zeigte, in vertikalem und
horizontalem Sinne weit ungleichmässiger sich verhalten müssten, als
dies der Fall ist. Die meisten verschwinden in den Alpen nach aufwärts
in derselben Reihenfolge, wie sie in den Ebenen Skandinaviens
und Russlands ihre Polargrenzen erreichen. Das gemeinsame Moment,
welches in der Dauer und Verkürzungsfähigkeit ihrer Vegetationsperiode
liegt, ist von grösserer Bedeutung, als die feineren
klimatischen Einflüsse, die ausserdem ihre Anordnung bestimmen
könnten. Wahlenberg hatte indessen bei seinen vergleichenden
Untersuchungen über die Vegetation der Schweiz und Lapplands
Abweichungen von dieser Symmetrie bemerkt und behauptet, dass
die Bäume in den nordischen Ebenen einem anderen Verbreitungsgesetze
folgten, als in den Waldregionen der Alpen. Dieser Ansicht
trat Martins entgegen, der nachwies, dass im Berner Oberlande
diese Verhältnisse den skandinavischen weit ähnlicher seien, als in
der nördlichen Schweiz, wo Wahlenberg seine Untersuchungen angestellt
hatte. Auf der Grimsel blieb ihm nur eine einzige Abweichung
übrig, als er die Höhengrenzen der dortigen Bäume mit ihren
Polargrenzen in Norwegen verglich. Diese Ausnahme ist auch jetzt
noch die einzige, allgemein und sicher nachgewiesene Thatsache
Verhältniss der Polar- und Höhengrenzen. 171
dieser Art, aber auch gerade desshalb einer näheren Untersuchung
Werth. Die Erscheinung besteht darin, dass die Buche in den Alpen
weit höher ansteigt, als die Eiche, wogegen wir gesehen haben, dass
die sogenannte Sommereiche [Quercus pedunmlatd) im Norden Europas
weit über die Buchengrenze hinausgeht. Die in den bayerischen
Alpen vonSendtner gemessenen Werthe ergeben für die Sommereiche
als Höhengrenze 2925 Fuss, für die Buche 4370 Fuss. Eine
physiologische Erklärung dieser Ungleichheit der Höhen- und Polargrenzen
geht aus den früher erörterten Beziehungen beider Bäume
zur Temperaturkurve hervor. Im Gebirge ist der Anfang und das
Ende der Vegetationsperiode zunächst durch die Dauer der Schneebedeckung
bestimmt, in welche der Winter die Gehänge einhüllt.
Von der Linie des ewigen Schnees, wo der Sommer denselben nicht
völlig zu verzehren vermag, folgt abwärts eine stetige Reihe von
Niveaus, wo man ihn allmälig früher verschwinden und im Herbste
sich später erneuern sieht. So lange der Schnee im Schmelzen begriffen
ist, steht die Temperatur seiner Umgebungen auf dem Gefrierpunkte
: Anfang und Ende der vegetativen Entwickelung ist also
durch die Zeitpunkte bestimmt, zu welchen die Sonnenwärme nicht
mehr zur Entfernung des Schnees verbraucht wird und das Erdreich
sich höher zu erwärmen im Stande ist. Die Vegetationszeit beginnt,
kurz nachdem die Schneedecke geschmolzen ist, sie endet, wenn
mit den ersten, vielleicht nur vorübergehenden Schneefällen des
Herbstes die Bodentemperatur plötzlich unter das Mass sinkt, bei
welchem phanerogamische Gewächse vegetiren können. Es fehlt
eine Periode, wo dieselbe, in niedrigen, aber über dem Gefrierpunkte
liegenden Werthen schwankend, noch bei gewissen Bäumen eine
Fortdauer der Blattfunktionen zulassen würde. Dieses Verhältniss
entspricht der Entwickelung der Buche, bei welcher zur Zeit der
Belaubung [8^) und des Blattfalls (6^) wenig geänderte Temperaturen
gefordert werden. Aber für die Eiche ist eine so gestaltete
Temperaturkurve ungünstig, da dieser Bauni sich bei einer höheren
Wärme (10ö) belaubt als die Buche, also nach der Entfernung des
Schnees bereits eine längere Zeit einbüsst und diesen Verlust nicht,
wie in den nordischen Ebenen, dadurch ersetzen kann, dass die
Blätter bei einer geringen Luftwärme (2 ö) sich noch erhalten können.
Dies verhindern die frühzeitigen Schneefälle. Die stärkere Wolken-
^ i' :