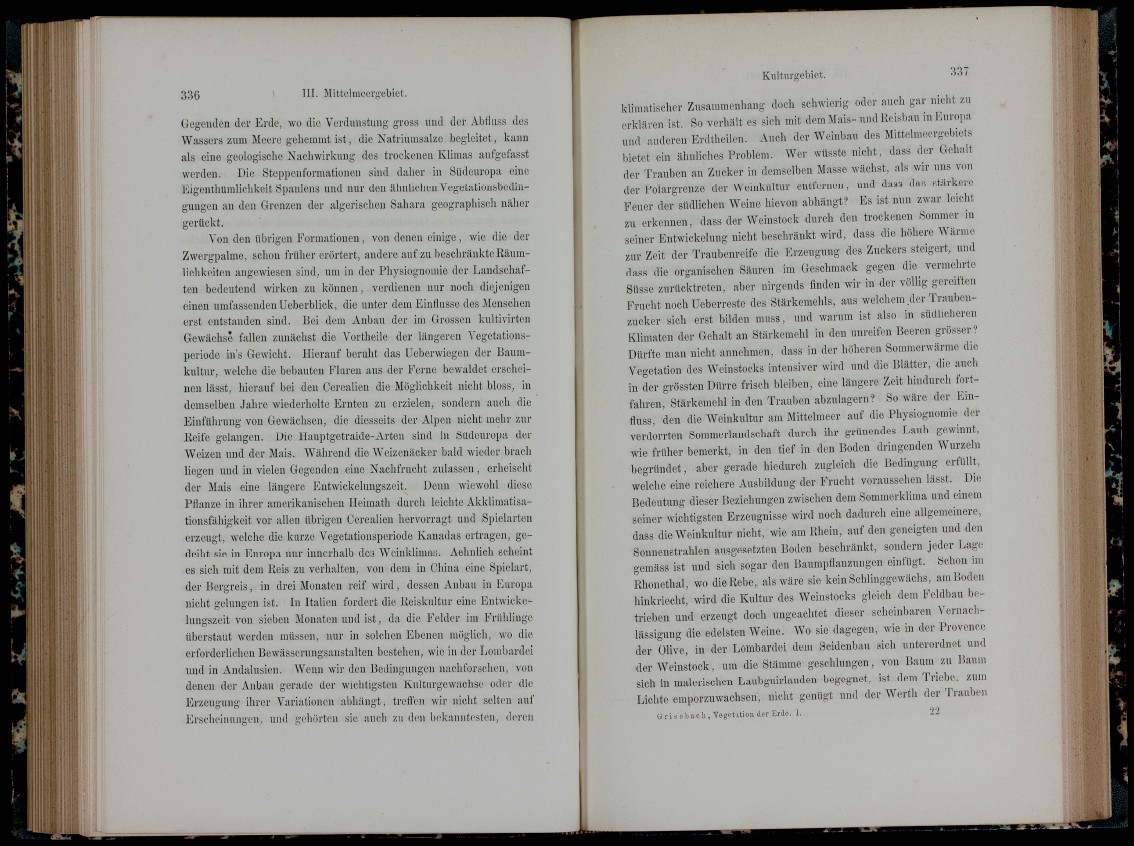
•i Hin
1
!l I
i
I!
336 III. Mittolmecvi^'obiet.
Gegenden der Erde, wo die Verdunstung gross und der Abfluss dos
Wassers zum Meere gehemmt ist, die Natriumsalze begleitet, kann
als eine geologische Nachwirkung des trockenen Klimas aufgeiasst
werden. Die Steppenformationen sind daher in Südeuropa eine
Eigenthümlichkeit Spaniens und nur den ähnlichen Vegetationsbedingungen
an den Grenzen der algerischen Sahara geograp]tisch näher
gerückt.
Von den übrigen Formationen, von denen einige, wie die der
Zwergpalme, schon früher erörtert, andere auf zu beschränkte Räumlichkeiten
angewiesen sind, um in der Physiognomie der Landschaften
bedeutend wirken zu können, verdienen nur noch diejenigen
einen umfassenden üeberblick, die unter dem Einflüsse des Menschen
erst entstanden sind. Bei dem Anbau der im Grossen kultivirten
Gewächse fallen zunächst die Vortheile der längeren Vegetationsperiode
in's Gewicht. Hierauf beruht das Ueberwiegen der Baumkultur,
welche die bebauten Fluren aus der Fßrne bewaldet erscheinen
lässt, hierauf bei den Cerealien die Möglichkeit nicht bloss, in
demselben Jahre wiederholte Ernten zu erzielen, sondern auch die
Einführung von Gewächsen, die diesseits der Alpen nicht mehr zur
Reife gelangen. Die Hauptgetraide-Arten sind in Südeuropa der
Weizen und der Mais. Während die Weizenäcker bald Avieder brach
liegen und in vielen Gegenden eine Nachfrucht zulassen, erheischt
der Mais eine längere Entwickelungszeit. Denn wiewohl diese
Pflanze in ihrer amerikanischen Heimath durch leichte Akklimatisationsfähigkeit
vor allen übrigen Cerealien hervorragt und Spielarten
erzeugt, welche die kurze Vegetationsperiode Kanadas ertragen, gedeiht
sie in Europa nur innerhalb des Weinklimas. Aehnlich scheint
es sich mit dem Reis zu verhalten, von dem in China eine Spielart,
der Bergreis, in drei Monaten reif wird, dessen Anbau in Europa
nicht gelungen ist. In Italien fordert die Reiskultur eine Entwickelungszeit
von sieben Monaten und ist, da die Felder im Frühlinge
überstaut werden müssen, nur in solchen Ebenen möglich, wo die
erforderlichen Bewässerungsanstalten bestehen, wie in der Lombardei
und in Andalusien. Wenn wir den Bedingungen nachforschen, von
denen der Anbau gerade der wichtigsten Kulturgewäclise oder die
Erzeugung ihrer Variationen abhängt, treifen wir nicht selten auf
Ersclieiiuingen, und gehörten sie aucli zu den bekanntesten, deren
1
Kultursebiet. 3 3 7
klimatischer Zusammenhang doch schwierig oder auch gar niclit zu
erklären ist. So verhält es sich mit dem Mais- und Reisbau ni Europa
und anderen Erdtheilen. Auch der Weinbau des Mittelmeergebiets
bietet ein ähnliches Problem. Wer wüsste nicht, dass der Gehalt
der Trauben an Zucker in demselben Masse wächst, als wir uns von
der Polargrenze der Weinkultur entfernen, und dass das stärkere
Feuer der südlichen Weine hievon abhängt? Es ist nun zwar leicht
zu erkennen, dass der Weinstock durch den trockenen Sommer in
seiner Entwickelung nicht beschränkt wird, dass die höhere Wärme
zur Zeit der Traubenreife die Erzeugung des Zuckers steigert, und
dass die organischen Säuren im Geschmack gegen die vermehrte
Süsse zurücktreten, aber nirgends finden wir in der völlig gereiften
Frucht noch üeberreste des Stärkemehls, aus welchem .der Traubenzucker
sich erst bilden muss, und warum ist also in südlicheren
Klimaten der Gehalt an Stärkemehl in den unreifen Beeren grösser?
Dürfte man nicht annehmen, dass in der höheren Sommerwärme die
Vegetation des Weinstocks intensiver wird und die Blätter, die auch
in der grössten Dürre frisch bleiben, eine längere Zeit hindurch fortfahren,
Stärkemehl in den Trauben abzulagern? So wäre der Einfluss,
den die Weinkultur am Mittelmeer auf die Physiognomie der
verdm-rten Sommerlandschaft durch ihr grünendes Laub gewinnt,
wie früher bemerkt, in den tief in den Boden dringenden Wurzeln
begründet, aber gerade hiedurch zugleich die Bedingung erfüllt,
welche eine reichere Ausbildung der Frucht voraussehen lässt. Die
Bedeutung dieser Beziehungen zwischen dem Sommerklima und einem
seiner wichtigsten Erzeugnisse wird noch dadurch eine allgemeinere,
dass die Weinkultur nicht, wie am Rhein, auf den geneigten und den
Sonnenstrahlen ausgesetzten Boden beschränkt, sondern jeder Lage
gemäss ist und sich sogar den Baumpflanzungen einfügt. Schon im
Rhonethal, wo die Rebe, als wäre sie kein Schlinggewächs, am Boden
hinkriecht, wird die Kultur des Weinstocks gleich dem Feldbau betrieben
und erzeugt doch ungeachtet dieser scheinbaren Vernachlässigung
die edelsten Weine. Wo sie dagegen, wie in der Provence
der Olive, in der Lombardei dem Seidenbau sich unterordnet und
der Weinstock, um die Stämme geschlungen, von Baum zu Baum
sich in malerischen Laubguirlanden begegnet, ist dem Triebe, zum
Lichte emporzuwachsen, nicht genügt und der Werth der Trauben
ü r i s eIj a ch , Vegetation der Erde. 1.
r \
i' !• '
Ii