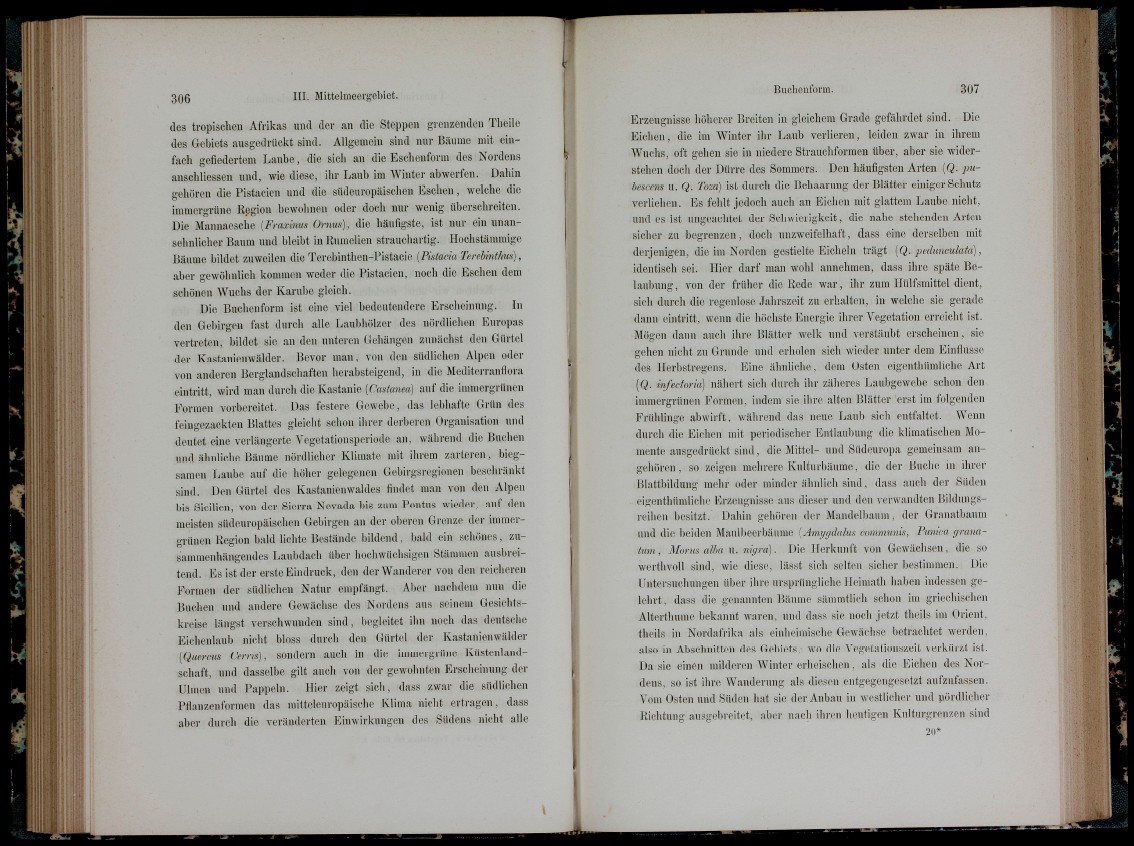
•ii
r ;
t . . ; J'
; i" Jii
, r.
, ' i ' '•
306 III. Mittelmeergebiet.
des tropischen Afrikas und der an die Steppen grenzenden Theile
des Gebiets ausgedrückt sind. Allgemein sind nur Bäume mit einfach
gefiedertem Laube, die sich an die Eschenform des Nordens
anschliessen und, wie diese, ihr Laub im Winter abwerfen. Dahin
gehören die Pistacien und die südeuropäischen Eschen, welche die
immergrüne Region bewohnen oder doch nur wenig überschreiten.
Die Mannaesche [Fraxinus Ornus], die häufigste, ist nur ein unansehnlicher
Baum und bleibt in Rumelien strauchartig. Hochstämmige
Bäume bildet zuweilen die Terebinthen-Pistacie [Pistacia Terehinthus),
aber gewöhnlich kommen weder die Pistacien, noch die Eschen dem
scliönen Wuchs der Karube gleich.
Die Buchenform ist eine viel bedeutendere Erscheinung. In
den Gebirgen fast durch alle Laubhölzer des nördlichen Europas
vertreten, bildet sie an den unteren Gehängen zunächst den Gürtel
der Kastanienwälder. Bevor man, von den südlichen Alpen oder
von anderen Berglandschaften herabsteigend, in die Mediterranflora
eintritt, wird man durch die Kastanie [Casianea) auf die immergrünen
Formen vorbereitet. Das festere Gewebe, das lebhafte Grün des
feingezackten Blattes gleicht schon ihrer derberen Organisation und
deutet eine verlängerte Vegetationsperiode an, während die Buchen
und ähnliche Bäume nördlicher Klimate mit ihrem zarteren, biegsamen
Laube auf die höher gelegenen Gebirgsregionen beschränkt
sind. Den Gürtel des Kastanienwaldes findet man von den Alpen
bis Sicilien, von der Sierra Nevada bis zum Pontus wieder, auf den
meisten südeuropäischen Gebirgen an der oberen Grenze der immergrünen
Region bald lichte Bestände bildend, bald ein schönes, zusammenhängendes
Lanbdach über hochwüchsigen Stämmen ausbreitend.
Es ist der erste Eindruck, den der Wanderer von den reicheren
Formen der südlichen Natur empfängt. Aber nachdem nun die
Buchen und andere Gewächse des Nordens aus seinem Gesichtskreise
längst verschwunden sind, begleitet ihn noch das deutsclie
Eichenlaub nicht bloss durch den Gürtel der Kastanienwälder
i Quej-cns Cerr is), sondern auch in die immergrüne Küstenland-
Schaft, lind dasselbe gilt auch von der gewohnten Erscheinung der
ühnen und Pappeln. Hier zeigt sich, dass zwar die südlichen
Pflanzenformen das mitteleuropäische Klima nicht ertragen, dass
aber durch die veränderten Einwirkungen des Südens nicht alle
Buchenform. 307
Erzeugnisse höherer Breiten in gleichem Grade gefährdet sind. Die
Eichen, die im Winter ihr Laub verlieren, leiden zwar in ihrem
Wuchs, oft gehen sie in niedere Strauchformen über, aber sie widerstehen
doch der Dürre des Sommers. Den häufigsten Arten (Q. jmhescem
u. Q. Toza) ist durch die Behaarung der Blätter einiger Schutz
verliehen. Es fehlt jedoch auch an Eichen mit glattem Laube nicht,
und es ist ungeachtet der Schwierigkeit, die nahe stehenden Arten
sicher zu begrenzen, doch unzweifelhaft, dass eine derselben mit
derjenigen, die im Norden gestielte Eicheln trägt {Q. pedunculata),
identisch sei. Hier darf man wohl annehmen, dass ihre späte Belaubung
, von der früher die Rede war, ihr zum Hülfsmittel dient,
sich durch die regenlose Jahrszeit zu erhalten, in welche sie gerade
dann eintritt, wenn die höchste Energie ihrer Vegetation erreiclit ist.
Mögen dann auch ihre Blätter welk und verstäubt erscheinen, sie
gehen nicht zu Grunde und erholen sich wieder unter dem Einflüsse
des Herbstregens. Eine älmliche, dem Osten eigenthümliche Art
(Q. infectoria) nähert sicli durch ihr zäheres Laubgewebe schon den
immergrünen Formen, indem sie ihre alten Blätter erst im folgenden
Frühlinge abwirft, während das neue Laub sich entfaltet. Wenn
durch die Eichen mit periodischer Entlaubung die klimatischen Momente
ausgedrückt sind, die Mittel- und Südeuropa gemeinsam angehören,
so zeigen mehrere Kulturbäume, die der Buche in ihrer
Blattbildung mehr oder minder ähnlich sind, dass auch der Süden
. eigenthümliche Erzeugnisse aus dieser und den verwandten Bildungsreihen
besitzt. Dahin gehören der Mandelbaum, der Granatbaum
und die beiden Maulbeerbäume [Ami/gdalus communis, Punica granaimn,
Morus alha u. nigra). Die Herkunft von Gewächsen, die so
werthvoll sind, wie diese, lässt sich selten sicher bestimmen. Die
Untersuchungen über ihre ursprüngliche Heimath haben indessen gelehrt,
dass die genannten Bäume sämmtlich schon im griechischen
Alterthume bekannt waren, und dass sie noch jetzt theils im Orient,
theils in Nordafrika als einheimische Gewächse betraclitet werden,
also in Abschnitten des Gebietsw^o die Yegetationszeit verkürzt ist.
Da sie einen milderen Winter erheischen, als die Eichen des Nordens,
so ist ihre Wanderung als diesen entgegengesetzt aufzufassen.
Vom Osten und Süden hat sie der Anbau in westlicher und nördlicher
Richtung ausgebreitet, aber nach ihren heutigen Kulturgrenzen sind
20^-
;
i: i
; •