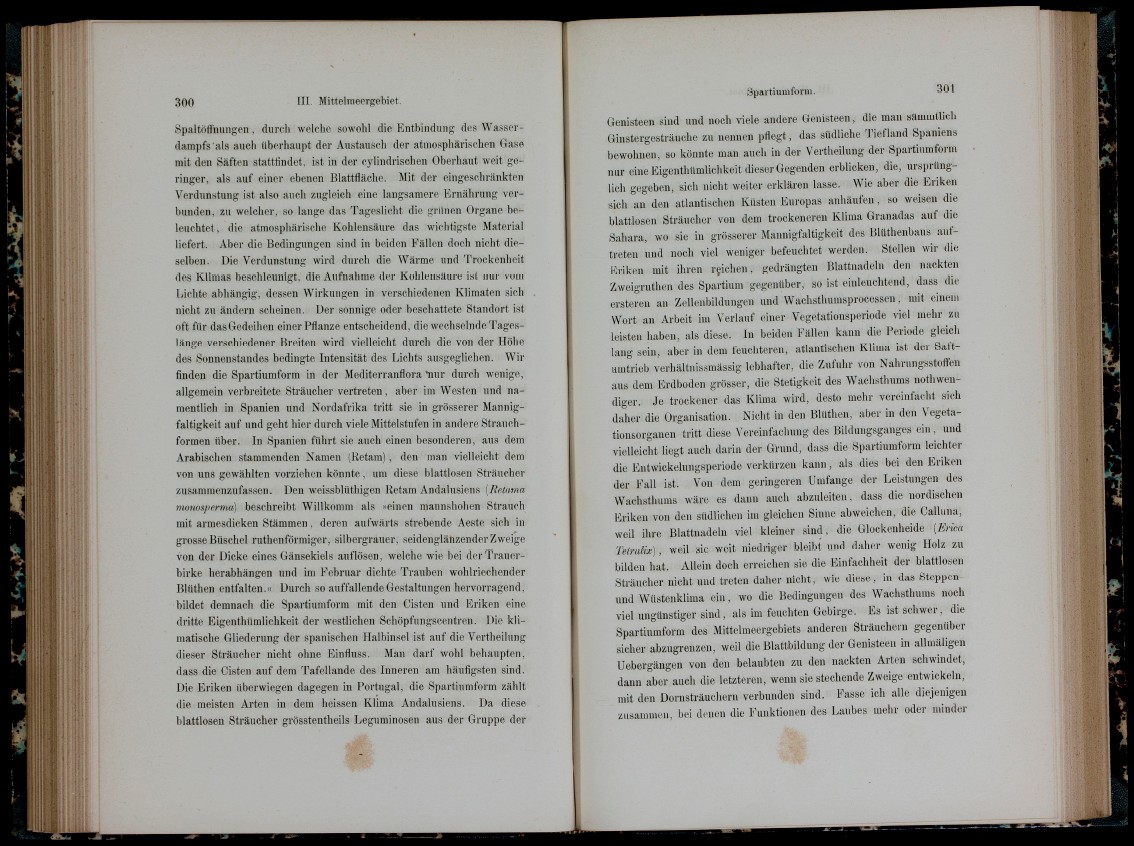
300 III. Mittelmeergebiet.
Spaltötfnungen, durch welche sowohl die Entbindung des Wasserdarapfs
'als auch überhaupt der Austausch der atmosphärischen Gase
mit den Säften stattfindet, ist in der cylindrischen Oberhaut weit geringer,
als auf einer ebenen Blattfläche. Mit der eingeschränkten
Verdunstung ist also auch zugleich eine langsamere Ernährung verbunden,
zu welcher, so lange das Tageslicht die grünen Organe beleuchtet,
die atmosphärische Kohlensäure das wichtigste Material
liefert. Aber die Bedingungen sind in beiden Fällen doch nicht dieselben.
Die Verdunstung wird durch die Wärme und Trockenheit
des Klimas beschleunigt, die Aufnahme der Kohlensäure ist nur vom
Lichte abhängig, dessen Wirkungen in verschiedenen Klimaten sich
nicht zu ändern scheinen. Der sonnige oder beschattete Standort ist
oft für das Gedeihen einer Pflanze entscheidend, die wechselnde Tageslänge
verschiedener Breiten wird vielleicht durch die von der Höhe
des Sonnenstandes bedingte Intensität des Lichts ausgeglichen. Wir
finden die Spartiumform in der Mediterranflora ^ur durch wenige,
allgemein verbreitete Sträucher vertreten, aber im Westen und namentlich
in Spanien und Nordafrika tritt sie in grösserer Mannigfaltigkeit
auf und geht hier durch viele Mittelstufen in andere Strauchformen
über. In Spanien führt sie auch einen besonderen, aus dem
Arabischen stammenden Namen (Retam), den man vielleicht dem
von uns gewählten vorziehen könnte, um diese blattlosen Sträucher
zusammenzufassen. Den weissblüthigen Retam Andalusiens [Retama
mo7iospernia) beschreibt Willkomm als ))einen mannshohen Strauch
mit armesdicken Stämmen, deren aufwärts strebende Aeste sich in
grosse Büschel ruthenförmiger, silbergrauer, seidengläüzender Zweige
von der Dicke eines Gänsekiels auflösen, welche wie bei der Trauerbirke
herabhängen und im Februar dichte Trauben wohlriechender
Blüthen entfalten.« Durch so auffallende Gestaltungen hervorragend,
bildet demnach die Spartiumform mit den Cisten und Eriken eine
dritte Eigenthümlichkeit der westlichen Schöpfungscentren. Die klimatische
Gliederung der spanischen Halbinsel ist auf die Vertheilung
dieser Sträucher nicht ohne Einfluss. Man darf wohl behaupten,
dass die Cisten auf dem Tafellande des Inneren am häufigsten sind.
Die Eriken überwiegen dagegen in Portugal, die Spartiumform zählt
die meisten Arten in dem heissen Klima Andalusiens. Da diese
blattlosen Sträucher grösstentheils Leguminosen aus der Gruppe der
Spartiumform. 301
Genisteen sind und noch viele andere Genisteen, die man sämmtlicli
Ginstergesträuche zu nennen pflegt, das südliche Tiefland Spaniens
bewohnen, so könnte man auch in der Vertheilung der Spartiumform
nur eine Eigenthümlichkeit dieser Gegenden erblicken, die, ursprünglich
gegeben, sich nicht weiter erklären lasse. Wie aber die Eriken
sich an den atlantischen Küsten Europas anhäufen, so weisen die
blattlosen Sträucher von dem trockeneren Klima Granadas auf die
Sahara, wo sie in grösserer Mannigfaltigkeit des Blüthenbaus auftreten
und noch viel weniger befeuchtet werden. Stellen wir die
Eriken mit ihren reichen, gedrängten Blattnadeln den nackten
Zweigruthen des Spartium gegenüber, so ist einleuchtend, dass die
ersteren an Zellenbildungen und Wachsthumsprocessen, mit einem
Wort an Arbeit im Verlauf einer Vegetationsperiode viel mehr zu
leisten haben, als diese. In beiden Fällen kann die Periode gleich
lang sein, aber in dem feuchteren, atlantischen Klima ist der Saftumtrieb
verhältnissmässig lebhafter, die Zufuhr von Nahrungsstoffen
aus dem Erdboden grösser, die Stetigkeit des Wachsthums nothwendiger.
Je trockener das Klima wird, desto mehr vereinfacht sich
daher die Organisation. Nicht in den Blüthen, aber in den Vegetationsorganen
tritt diese Vereinfachung des Bildungsganges ein, und
vielleicht liegt auch darin der Grund, dass die Spartiumform leichter
die Entwickelungsperiode verkürzen kann, als dies bei den Eriken
der Fall ist. Von dem geringeren Umfange der Leistungen des
Wachsthums wäre es dann auch abzuleiten, dass die nordischen
Eriken von den südlichen im gleichen Sinne abweichen, die Calluna,
weil ihre Blattnadeln viel kleiner sind, die Glockenheide [Erica
Tetralix), weil sie weit niedriger bleibt und daher wenig Holz zu
bilden hat. Allein doch erreichen sie die Einfachheit der blattlosen
Sträucher nicht und treten daher nicht, wie diese, in das Steppenund
Wüstenklima ein, wo die Bedingungen des Wachsthums noch
viel ungünstiger sind, als im feuchten Gebirge. Es ist schwer, die
Spartiumform des Mittelmeergebiets anderen Sträuchern gegenüber
sicher abzugrenzen, weil die Blattbildung der Genisteen in allmäligen
Uebergängen von den belaubten zu den nackten Arten schwindet,
dann aber auch die letzteren, wenn sie stechende Zweige entwickeln,
mit den Dornsträuchern verbunden sind. Passe ich alle diejenigen
zusammen, bei denen die Funktionen des Laubes mehr oder minder
. \