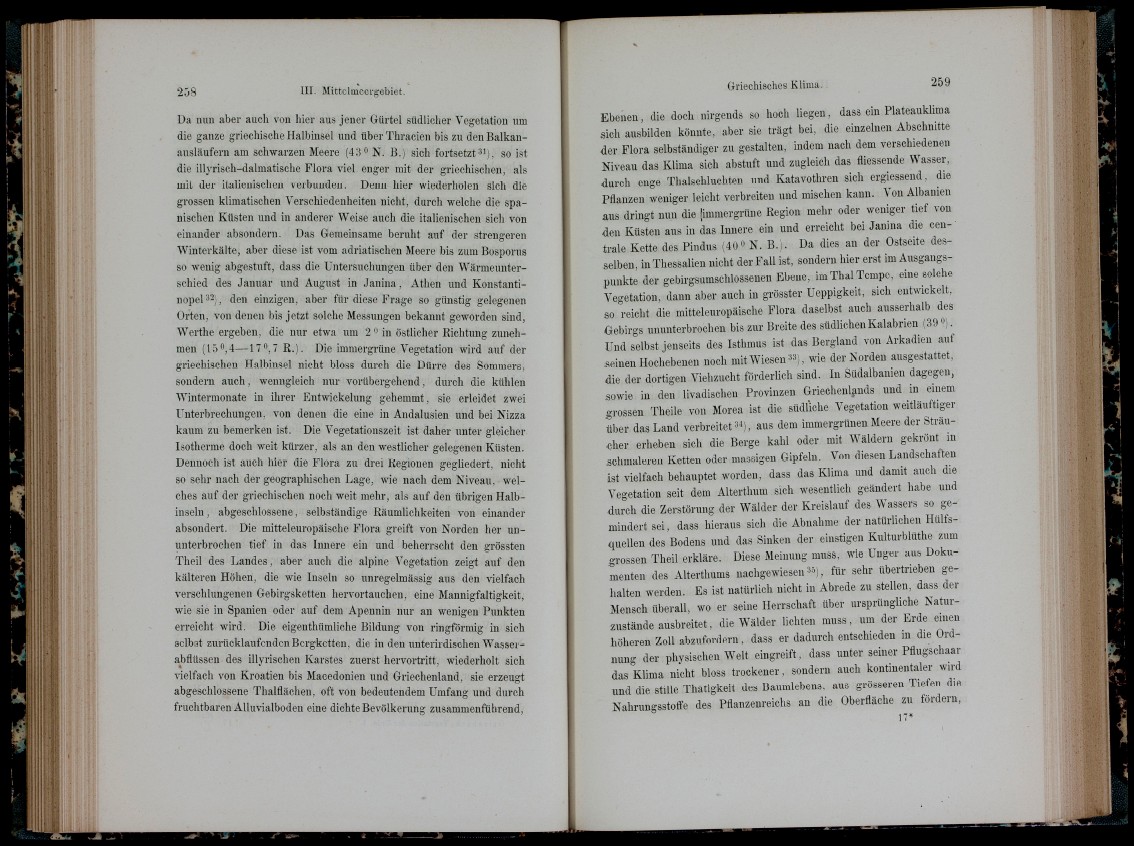
(il 1
tI •[ 1 I
a
-Ni
• ¡¡,-
I •
b'
i'Ii
•f
258 •k III. Mittelmeergebiet.
Da nun aber auch von hier aus jener Gürtel südlicher Vegetation um
die ganze griechische Halbinsel und überThracien bis zu den Balkanausläufern
am schwarzen Meere (43 ^ N. B.) sich fortsetzt so ist
die illyrisch-dalmatische Flora viel enger mit der griechischen, als
mit der italienischen verbunden. Denn hier wiederholen sich die
grossen klimatischen Verschiedenheiten nicht, durch welche die spanischen
Küsten und in anderer Weise auch die italienischen sich von
einander absondern. Das Gemeinsame beruht auf der strengeren
Winterkälte, aber diese ist vom adriatischen Meere bis zum Bosporus
so wenig abgestuft, dass die Untersuchungen über den Wärmeunterschied
des Januar und August in Janina, Athen und KonstantinopeP^),
den einzigen, aber für diese Frage so günstig gelegenen
Orten, von denen bis jetzt solche Messungen bekannt geworden sind,
Werthe ergeben, die nur etwa um 2 ^ in östlicher Richtung zunehmen
(15^4—17 0^7 R.). Die immergrüne Vegetation wird auf der
griechischen Halbinsel nicht bloss durch die Dürre des Sommers,
sondern auch, wenngleich nur vorübergehend, durch die kühlen
Wintermonate in ihrer Entwickelung gehemmt, sie erleidet zwei
Unterbrechungen, von denen die eine in Andalusien und bei Nizza
kaum zu bemerken ist. Die Vegetationszeit ist daher unter gleicher
Isotherme doch weit kürzer, als an den westlicher gelegenen Küsten.
Dennoch ist auch hier die Flora zu drei Regionen gegliedert, nicht
so sehr nach der geographischen Lage, wie nach dem Niveau, welches
auf der griechischen noch weit mehr, als auf den übrigen Halbinseln
, abgeschlossene, selbständige Räumlichkeiten von einander
absondert. Die mitteleuropäische Flora greift von Norden her ununterbrochen
tief in das Innere ein und beherrscht den grössten
Theil des Landes, aber auch die alpine Vegetation zeigt auf den
kälteren Höhen, die wie Inseln so unregelmässig aus den vielfach
verschlungenen Gebirgsketten hervortauchen, eine Mannigfaltigkeit,
wie sie in Spanien oder auf dem Apennin nur an wenigen Punkten
erreicht wird. Die eigenthümliche Bildung von ringförmig in sich
selbst zurücklaufenden Bergketten, die in den unterirdischen Wasserabflüssen
des illyrischen Karstes zuerst hervortritt, wiederholt sich
vielfach von Kroatien bis Macédonien und Griechenland, sie erzeugt
abgeschlossene Thalflächen, oft von bedeutendem Umfang und durch
fruchtbaren Alluvialboden eine dichte Bevölkerung zusammenführend.
Griechisches Klima. 259
Ebenen, die doch nirgends so hoch liegen, dass ein Plateauklima
Äich ausbilden könnte, aber sie trägt bei, die einzelnen Abschnitte
der Flora selbständiger zu gestalten, indem nach dem verschiedenen
Niveau das Klima sich abstuft und zugleich das fliessende Wasser,
durch enge Thalschluchten und Katavothren sich ergiessend, die
Pflanzen weniger leicht verbreiten und mischen kann. Von Albanien
^us dringt nun die (immergrüne Region mehr oder weniger tief von
den Küsten aus in das Innere ein und erreicht bei Janina die centrale
Kette des Pindus (40 o N. B.). Da dies an der Ostseite des-
.sclben in Thessalien nicht der Fall ist, sondern hier erst im Ausgangspunkte
der gebirgsumschlossenen Ebene, imThalTempe, eine solche
Vegetation, dann aber auch in grösster Ueppigkeit, sich entwickelt,
,^0 reicht die mitteleuropäische Flora daselbst auch ausserhalb des
Gebirgs ununterbrochen bis zur Breite des südlichenKalabrien (39 o).
Und selbst jenseits des Isthmus ist das Bergland von Arkadien auf
.seinen Hochebenen noch mit Wiesen 33), wie der Norden ausgestattet,
die der dortigen Viehzucht förderlich sind. In Südalbanien dagegen,
sowie in den livadischen Provinzen Griechenlands und in einem
grossen Theile von Morea ist die südliche Vegetation weitläufiger
über das Land verbreitet 3^), aus dem immergrünen Meere der Sträu-
<iher erheben sich die Berge kahl oder mit Wäldern gekrönt in
.schmaleren Ketten oder massigen Gipfeln. Von diesen Landschaften
ist vielfach behauptet worden, dass das Klima und damit auch die
Vegetation seit dem Alterthum sich wesentlich geändert habe und
durch die Zerstörung der Wälder der Kreislauf des Wassers so gemindert
sei, dass hieraus sich die Abnahme der natürlichen Hülfsquellen
des Bodens und das Sinken der einstigen Kulturblüthe zum
grossen Theil erkläre. Diese Meinung muss, wie Unger aus Dokumenten
des Alterthums nachgewiesen 35), für sehr übertrieben gehalten
werden. Es ist natüriich nicht in Abrede zu stellen, dass der
Mensch überall, wo er seine Herrschaft über ursprüngliche Naturmxstände
ausbreitet, die Wälder lichten muss, um der Erde einen
höheren Zoll abzufordern, dass er dadurch entschieden m die Ordnung
der physischen Welt eingreift, dass unter seiner Pflugschaar
das Klima nicht bloss trockener, sondern auch kontinentaler wird
und die stille Thätigkeit des Baumlebens, aus grösseren Tiefen die
Nahrungsstoffe des Pflanzenreichs an die Oberfläche zu fördern,
17*