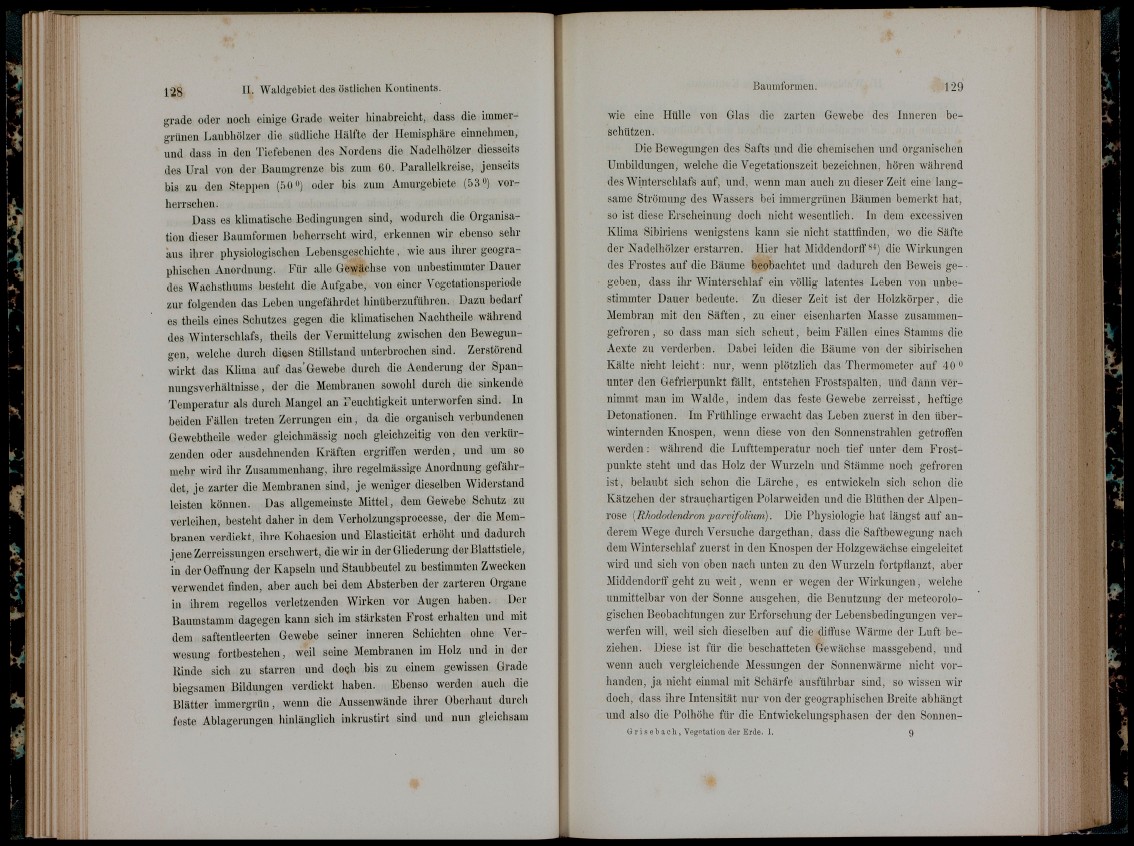
1 ^
i
M
1 1
• 1
i i
i ;I i -i
; 1
1-1
J• l T\ :
i... .1
I<i1- •' i,
tii-'
'IiJi ;; •
Ii
128 II. Walda-ebiet des östlichen Kontinents.
grade oder noch einige Grade weiter lünabreicht; dass die immergrünen
Laubliölzer die südliche Hälfte der Hemisphäre einnehmen,
und dass in den Tiefebenen des Nordens die Nadelhölzer diesseits
des Ural von der Baumgrenze bis zum 60. Parallelkreise, jenseits
bis zu den Steppen oder bis zum Amurgebiete (53vorherrschen.
Dass es klimatische Bedingungen sind, wodurch die Organisation
dieser Baumformen beherrscht wird, erkennen wir ebenso sehr
aus ihrer physiologischen Lebensgeschichte, wie aus ihrer geographischen
Anordnung. Für alle Gewächse von unbestimmter Dauer
des Wachsthums besteht die Aufgabe, von einer Vegetationsperiode
zur folgenden das Leben ungefährdet hinüberzuführen. Dazu bedarf
es theils eines Schutzes gegen die klimatischen Nachtheile während
des Winterschlafs, theils der Vermittelung zwischen den Bewegungen,
welche durch diesen Stillstand unterbrochen sind. Zerstörend
wirkt das Klima auf das^Gewebe durch die Aenderung der Spannungsverhältnisse,
der die Membranen sowohl durch die sinkende
Temperatur als durch Mangel an Teuchtigkeit unterworfen sind. In
beiden Fällen treten Zerrungen ein, da die organisch verbundenen
Gewebtheile weder gleichmässig noch gleichzeitig von den verkürzenden
oder ausdehnenden Kräften ergriffen werden, und um so
mehr wird ihr Zusammenhang, ihre regelmässige Anordnung gefährdet,
je zarter die Membranen sind, je weniger dieselben Widerstand
leisten können. Das allgemeinste Mittel, dem Gewebe Schutz zu
verleihen, besteht daher in dem Verholzungsprocesse, der die Membranen
verdickt, ihre Kohaesion und Elasticität erhöht und dadurch
jeneZerreissungen erschwert, die wir in der Gliederung der Blattstiele,
in derOeifnung der Kapseln und Staubbeutel zu bestimmten Zwecken
verwendet finden, aber auch bei dem Absterben der zarteren Organe
in ihrem regellos verletzenden Wirken vor Augen haben. Der
Baumstamm dagegen kann sich im stärksten Frost erhalten und mit
dem saftentleerten Gewebe seiner inneren Schichten ohne Verwesung
fortbestehen, weil seine Membranen im Holz und in der
Rinde sich zu starren und doQh bis zu einem gewissen Grade
biegsamen Bildungen verdickt haben. Ebenso werden auch die
Blättei' immergrün, wenn die Aussenwände ihrer Oberhaut durcli
feste Ablagerungen lünlänglich inkrustirt sind und nun gleichsam
Baumformen. 129
wie eine Hülle von Glas die zarten Gewebe des Inneren beschützen.
Die Bewegungen des Safts und die cliemisclien und organischen
Umbildungen, welche die Vegetationszeit bezeichnen, hören während
des Winterschlafs auf, und, wenn man auch zu dieser Zeit eine langsame
Strömling des Wassers bei immergrünen Bäumen bemerkt hat,
so ist diese Erscheinung doch nicht wesentlich. In dem excessiven
Klima Sibiriens wenigstens kann sie nicht stattfinden, wo die Säfte
der Nadelhölzer erstarren. Hier hat MiddendoriF^^^) die Wirkungen
des Frostes auf die Bäume beobachtet und dadurch den Beweis gegeben,
dass ihr Winterschlaf ein völlig latentes Leben von unbestimmter
Dauer bedeute. Zu dieser Zeit ist der Holzkörper, die
Membran mit den Säften, zu einer eisenharten Masse zusammengefroren
, so dass man sich scheut, beim Fällen eines Stamms die
Aexte zu verderben. Dabei leiden die Bäume von der sibirischen
Kälte nicht leicht: nur, wenn plötzlich das Thermometer auf 40^
unter den Gefrierpunkt fällt, entstehen Frostspalten, und dann vernimmt
man im Walde, indem das feste Gewebe zerreisst, heftige
Detonationen. Im Frühlinge erwacht das Leben zuerst in den überwinternden
Knospen, wenn diese von den Sonnenstrahlen getroffen
werden: während die Lufttemperatur noch tief unter dem Frostpunkte
steht und das Holz der Wurzeln und Stämme noch gefroren
ist, belaubt sich schon die Lärche, es entwickeln sich schon die
Kätzchen der strauchartigen Polarweiden und die Blüthen der Alpenrose
{ R h o d o d e n d r o n p a m y o l h i m ) , Die Physiologie hat längst auf anderem
Wege dul'ch Versuche dargethan, dass die Saftbewegung nach
dem Winterschlaf zuerst in den Knospen der Holzgewächse eingeleitet
wird und sich von oben nach unten zu den Wurzeln fortpflanzt, aber
Middendorff geht zu weit, wenn er wegen der Wirkungen, welche
unmittelbar von der Sonne ausgehen, die Benutzung der meteorologischen
Beobachtungen zur Erforschung der Lebensbedingungen verwerfen
will, weil sich dieselben auf die diffuse Wärme der Luft beziehen.
Diese ist für die beschatteten Gewächse massgebend, und
wenn auch vergleichende Messungen der Sonnenwärme nicht vorhanden,
ja nicht einmal mit Schärfe ausführbar sind, so wissen wir
doch, dass ihre Intensität nur von der geographischen Breite abhängt
und also die Polhöhe für die Entwickelungsphasen der den Sonnen-
Gr i s e b a c h , Vegetation der Erde. 1. 9
( .
I fi