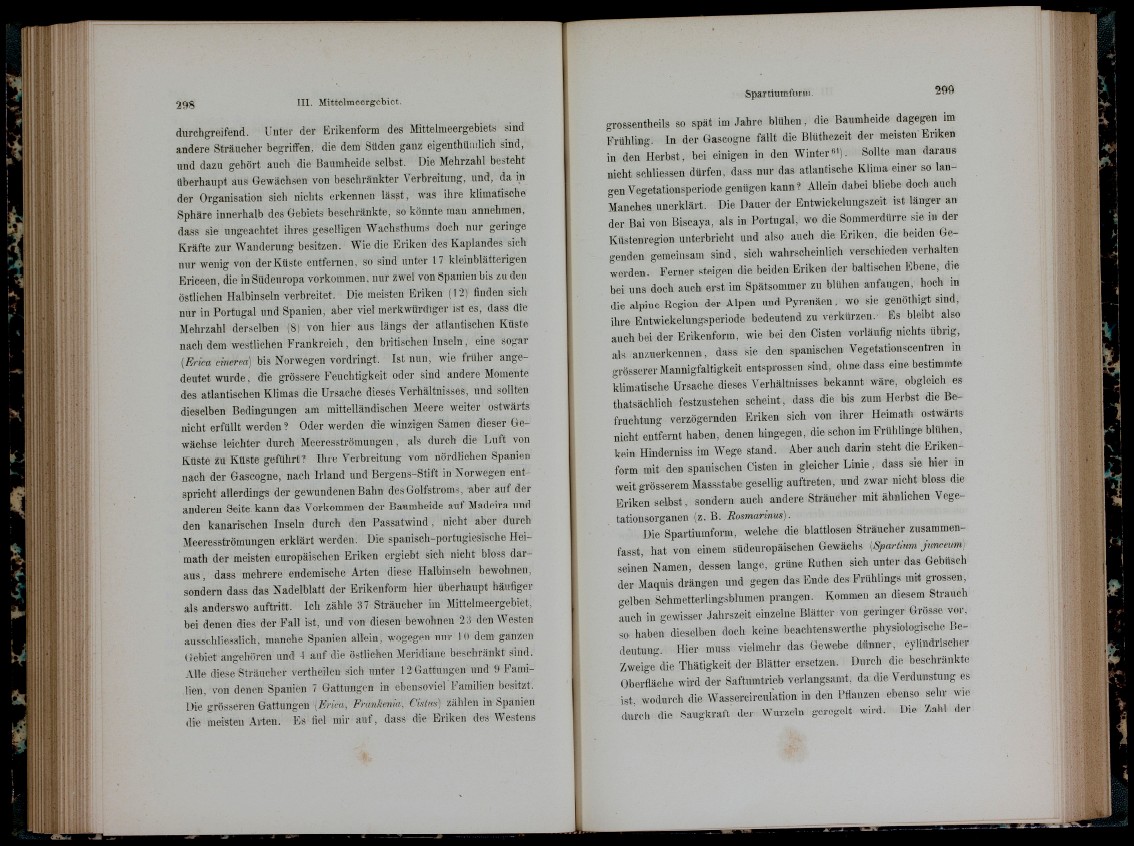
!
298 III. Mittelmeergebiet.
durchgreifend. Unter der Erikenform des Mittelmeergebiets sind
andere Sträucher begriffen, die dem Süden ganz eigenthüiiilich sind,
und dazu gehört auch die Baumheide selbst. Die Mehrzahl besteht
überhaupt aus Gewächsen von beschränkter Verbreitung, und, da in
der Organisation sich nichts erkennen lässt, was ihre klimatische
Sphäre innerhalb des Gebiets beschränkte, so könnte mau annehmen,
dass sie ungeachtet ihres geselligen Wachsthums doch nur geringe
Kräfte zur Wanderung besitzen. Wie die Eriken des Kaplandes sich
nur wenig von der Küste entfernen, so sind unter 17 kleinblätterigen
Ericeen, die in Südeuropa vorkommen, uur zwei von Spanien bis zu den
östlichen Halbinseln verbreitet. Die meisten Eriken {12) finden sich
nur in Portugal und Spanien, aber viel merkwürdiger ist es, dass die
Mehrzahl derselben (8) von hier aus längs der atlantischen Küste
nach dem westlichen Frankreich, den britischen Inseln, eine sogar
[Erica cinerea) bis Norwegen vordringt. Ist nun, wie früher angedeutet
wurde, die grössere Feuchtigkeit oder sind andere Momente
des atlantischen Klimas die Ursache dieses Verhältnisses, und sollten
dieselben Bedingungen am mittelländischen Meere weiter ostwärts
nicht erfüllt werden? Oder werden die winzigen Samen dieser Gewächse
leichter durch Meeresströmungen, als durch die Luft von
Küste zu Küste geführt? Ihre Verbreitung vom nördlichen Spanien
nach der Gascogne, nach Irland und Bergens-Stift in Norwegen entspricht
allerdings der gewundenen Bahn des Golfstroms, aber auf der
anderen Seite, kann das Vorkommen der Baumheide auf Madeira und
den kanarischen Inseln durch den Passatwind, nicht aber durch
Meeresströmungen erklärt werden. Die spanisch-portugiesische Heimath
der meisten europäischen Eriken ergiebt sich nicht bloss daraus
, dass mehrere endemische Arten diese Halbinseln bewohnen,
sondern dass das Nadelblatt der Erikenform hier überhaupt häufiger
als anderswo auftritt. Ich zähle 37 Sträucher im Mittelmeergebiet,
bei denen dies der Fall ist, und von diesen bewohnen 23 den Westen
ausschliesslich, manche Spanien allein, wogegen nur 10 dem ganzen
Gebiet angehören und 4 auf die östlichen Meridiane beschränkt sind.
Alle diese Sträucher vertheilen sich unter 12 Gattungen und 9 Familien,
von denen Spanien 7 Gattungen in ebensoviel Familien besitzt.
Die grösseren Gattungen \Erica, Frankenia, Cistus) zählen in Spanien
die meisten Arten. Es fiel mir auf, dass die Eriken des Westens
Spartiumforni. 299
Ii :!l
grossentheils so spät im Jahre blühen, die Baumheide dagegen im
Frühling. In der Gascogne fällt die Blüthezeit der meisten Eriken
in den Herbst, bei einigen in den Winteröl). Sollte man daraus
nicht schliessen dürfen, dass nur das atlantische Klima einer so langen
Vegetationsperiode genügen kann? Allein dabei bliebe doch auch
Manches unerklärt. Die Dauer der Entwicklungszeit ist länger an
der Bai von Biscaya, als in Portugal, wo die Sommerdürre sie in der
Küstenregion unterbricht und also auch die Eriken, die beiden Gegenden
gemeinsam sind, sich wahrscheinlich verschieden verhalten
werden. Ferner steigen die beiden Eriken der baltischen Ebene, die
bei uns doch auch erst im Spätsommer zu blühen anfangen, hoch in
die alpine Region der Alpen und Pyrenäen, wo sie genöthigt sind,
ihre Entwickelungsperiode bedeutend zu verkürzen. Es bleibt also
auch bei der Erikenform, wie bei den Cisten vorläufig nichts übrig,
als anzuerkennen, dass sie den spanischen Vegetationscentren in
grösserer Mannigfaltigkeit entsprossen sind, ohne dass eine bestimmte
klimatische Ursache dieses Verhältnisses bekannt wäre, obgleich es
thatsächlich festzustehen scheint, dass die bis zum Herbst die Befruchtung
verzögernden Eriken sich von ihrer Heimath ostwärts
nicht entfernt haben, denen hingegen, die schon im Frühlinge blühen,
kein Hinderniss im Wege stand. Aber auch darin steht die Erikenform
mit den spanischen Cisten in gleicher Linie, dass sie hier in
weit grösserem Massstabe gesellig auftreten, und zwar nicht bloss die
Eriken selbst, sondern auch andere Sträucher mit ähnlichen Vegetationsorganen
(z. B. Rosmarinus).
Die Spartiumform, welche die blattlosen Sträucher zusammenfasst,
hat von einem südeuropäischen Gewächs [Spartium junceum]
seinen Namen, dessen lange, grüne Ruthen sich unter das Gebüsch
der Maquis drängen und gegen das Ende des Frühlings mit grossen,
gelben Schmetterlingsblumen prangen. Kommen an diesem Strauch
auch in gewisser Jahrszeit einzelne Blätter von geringer Grösse vor,
so haben dieselben doch keine beachtenswerthe physiologische Bedeutung.
Hier muss vielmehr das Gewebe dünner, cylindrischer
Zweige die Thätigkeit der Blätter ersetzen. Durch die beschränkte
Oberfläche wird der Saftumtrieb veriangsamt, da die Verdunstung es
ist, wodurch die Wassercirculation in den Pflanzen ebenso sehr wie
durch die Saugkraft der Wurzeln geregelt wird. Die Zahl der
-••iia;
t
.. • . •