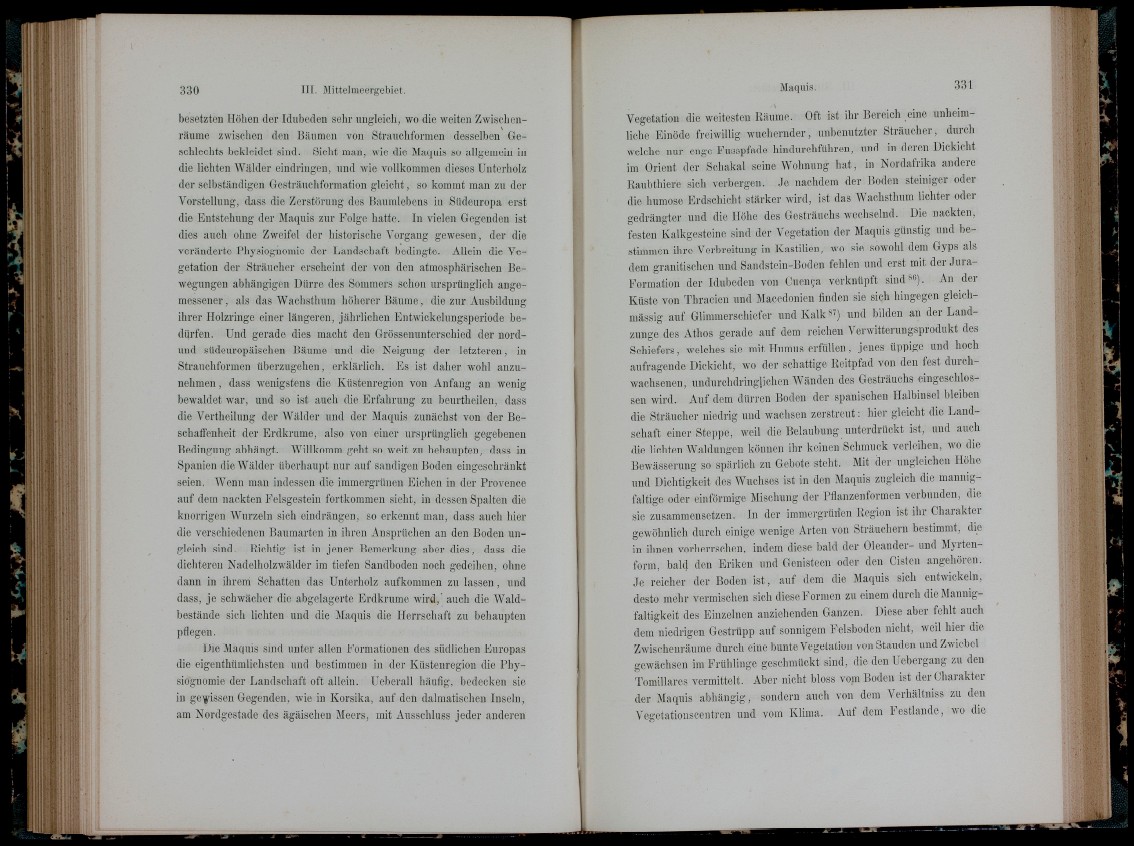
330 III. Mittelmeergebiet. Maquis. 331
I
Ii: >
besetzten Höhen der Idubeden sehr ungleich^ wo die weiten Zwischenräume
zwischen den Bäumen von Strauchformen desselben Geschlechts
bekleidet sind. Sieht man, wie die Maquis so allgemein in
die lichten Wälder eindringen^ und wie vollkommen dieses Unterholz
der selbständigen Gesträuchformation gleicht, so kommt man zu der
Vorstellung, dass die Zerstörung des Baumlebens in Südeuropa erst
die Entstehung der Maquis zur Folge hatte. In vielen Gegenden ist
dies auch ohne Zweifel der historische Vorgang gewesen, der die
veränderte Physiognomie der Landschaft bedingte. Allein die Vegetation
der Sträucher erscheint der von den atmosphärischen Bewegungen
abhängigen Dürre des Sommers schon ursprünglich angemessener,
als das Wachsthum höherer Bäume, die zur Ausbildung
ihrer Holzringe einer längeren, jährlichen Entwickelungsperiode bedürfen.
Und gerade dies macht den Grössenunterschied der nordund
südeuropäischen Bäume und die Neigung der letzteren, in
Strauchformen überzugehen, erklärlich. Es ist daher wohl anzunehmen
, dass wenigstens die Küstenregion von Anfang an wenig
bewaldet war, und so ist auch die Erfahrung zu beurtheilen, dass
die Vertheilung der Wälder und der Maquis zunächst von der Beschaffenheit
der Erdkrume, also von einer ursprünglich gegebenen
Bedingung abhängt. Willkomm geht so weit zu behaupten, dass in
Spanien die Wälder überhaupt nur auf sandigen Boden eingeschränkt
seien. Wenn man indessen die immergrünen Eichen in der Provence
auf dem nackten Felsgestein fortkommen sieht, in dessen Spalten die
knorrigen Wurzeln sich eindrängen, so erkennt man, dass auch hier
die verschiedenen Baumarten in ihren Ansprüchen an den Boden ungleich
sind. Richtig ist in jener Bemerkung aber dies, dass die
dichteren Nadelholzwälder im tiefen Sandboden noch gedeihen, ohne
dann in ihrem Schatten das Unterholz aufkommen zu lassen, und
dass, j e schwächer die abgelagerte Erdkrume wird,' auch die Waldbestände
sich lichten und die Maquis die Herrschaft zu behaupten
pflegen.
Die Maquis sind unter allen Formationen des südlichen Europas
die eigenthümlichsten und bestimmen in der Küstenregion die Physiognomie
der Landschaft oft allein. Ueberall häufig, bedecken sie
in gewissen Gegenden, wie in Korsika, auf den dalmatischen Inseln,
am Nordgestade des ägäischen MeerS; mit Ausschluss jeder anderen
Vegetation die weitesten Räume. Oft ist ihr Bereich ,eine unheimliche
Einöde freiwillig wuchernder, unbenutzter Sträucher, durch
welche nur enge Fusspfade hindurchführen, und in deren Dickicht
im Orient der Schakal seine Wohnung hat, in Nordafrika andere
Raubthiere sich verbergen. Je nachdem der Boden steiniger oder
die humóse Erdschicht stärker wird, ist das Wachsthum lichter oder
gedrängter und die Höhe des Gesträuchs wechselnd. Die nackten,
festen Kalkgesteine sind der Vegetation der Maquis günstig und bestimmen
ihre Verbreitung in Kastilien, wo sie sowohl dem Gyps als
dem granitischen und Sandstein-Boden fehlen und erst mit der Jura-
Formation der Idubeden von Cuença verknüpft sind An der
Küste von Thracien und Macédonien finden sie sich hingegen gleichmassig
auf Glimmerschiefer und Kalk®^) und bilden an der Landzunge
des Athos gerade auf dem reichen Verwitterungsprodukt des
Schiefers, welches sie mit Humus erfüllen, jenes üppige und hoch
aufragende Dickicht, wo der schattige Reitpfad von den fest durchwachsenen,
undurchdringlichen Wänden des Gesträuchs eingeschlossen
wird. Auf dem dürren Boden der spanischen Halbinsel bleiben
die Sträucher niedrig und wachsen zerstreut : hier gleicht die Landschaft
einer Steppe, weil die Belaubung unterdrückt ist, und auch
die lichten Waldungen können ihr keinen Schmuck verleihen, wo die
Bewässerung so spärlich zu Gebote steht. Mit der ungleichen Höhe
und Dichtigkeit des Wuchses ist in den Maquis zugleich die mannigfaltige
oder einförmige Mischung der Pflanzenformen verbiinden, die
sie zusammensetzen. In der immergrünen Region ist ihr Charakter
gewöhnlich durch einige wenige Arten von Sträuchern bestimmt, die
in ihnen vorherrschen, indem diese bald der Oleander- und Myrtenform,
bald den Eriken und Genisteen oder den Cisten angehören.
J e rdcher der Boden ist, auf dem die Maquis sich entwickeln,
desto mehr vermischen sich diese Formen zu einem durch die Mannigfaltigkeit
des Einzelnen anziehenden Ganzen. Diese aber fehlt auch
dem niedrigen Gestrüpp auf sonnigem Felsboden nicht, weil hier die
Zwischenräume durch eine bunte Vegetation von Stauden und Zwiebelgewächsen
im Frühlinge geschmückt sind, die den Uebergang zu den
Tomillares vermittelt. Aber nicht bloss vom Boden ist der Charakter
der Maquis abhängig, sondern auch von dem Verhältniss zu den
Vegetationscentren und vom Klima. Auf dem Festlande, wo die
I