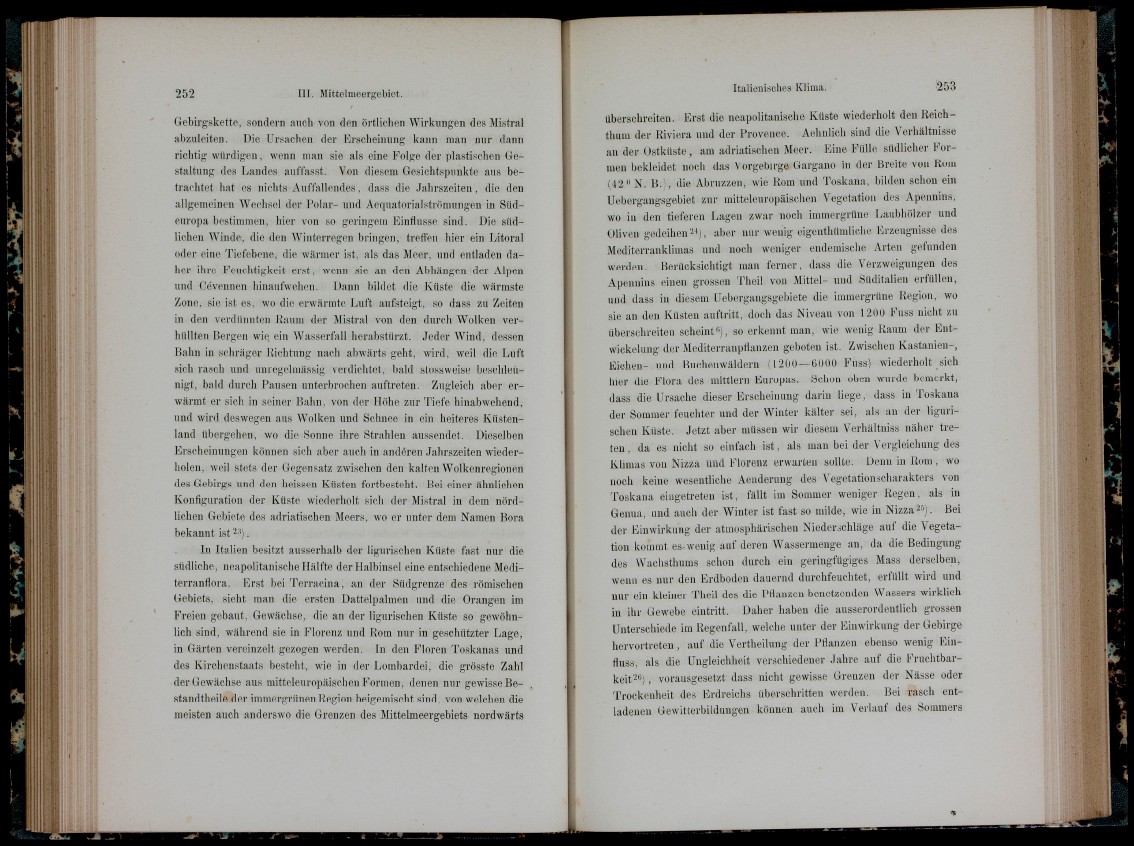
. . . .. •••- ' ^ , m--. :
1
'i:
252
* : •
:l: i!l
.•!•-• i
H .'i
i
' I ' I
Iii! i Iii.
i
III. Mittelmeergebiet.
Gebirgskette, sondern anch von den örtlichen Wirkungen des Mistral
abzuleiten. Die Ursachen der Erscheinung kann man nnr dann
richtig würdigen, wenn man sie als eine Folge der plastischen Gestaltung
des Landes auffasst. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet
hat es nichts Auffallendes, dass die Jahrszeiten, die den
allgemeinen Wechsel der Polar- und Aequatorialströmungen in Südeuropa
bestimmen, hier von so geringem Einflüsse sind. Die südlichen
Winde, die den Winterregen bringen, treffen hier ein Litoral
oder eine Tiefebene, die wärmer ist, als das Meer, und entladen daher
ihre Feuchtigkeit erst, wenn sie an den Abhängen der Alpen
und Cevennen hinaufwehen. Dann bildet die Küste die wärmste
Zone, sie ist es, wo die erwärmte Luft aufsteigt, so dass zu Zeiten
in den verdünnten Raum der Mistral von den durch Wolken verhüllten
Bergen wie ein Wasserfall herabstürzt. Jeder Wind, dessen
Bahn in schräger Richtung nach abwärts geht, wird, weil die Lnft
sich rasch nnd unregelmässig verdichtet, bald stossweise beschleunigt,
bald durch Pausen unterbrochen auftreten. Zugleich aber erwärmt
er sich in seiner Bahn, von der Höhe zur Tiefe hinabwehend,
und wird deswegen aus Wolken und Schnee in ein heiteres Küstenland
übergehen, wo die Sonne ihre Strahlen aussendet. Dieselben
Erscheinungen können sich aber auch in anderen Jahrszeiten wiederholen,
weil stets der Gegensatz zwischen den kalten Wolkenregionen
des Gebirgs und den heissen Küsten fortbesteht. Bei einer ähnlichen
Konfiguration der Küste wiederholt sich der Mistral in dem nördlichen
Gebiete des adriatischen Meers, wo er unter dem Namen Bora
bekannt ist .
In Italien besitzt ausserhalb der ligurischen Küste fast nur die
südliche, neapolitanische Hälfte der Halbinsel eine entschiedene Mediterranflora.
Erst bei Terracina, an der Südgrenze des römischen
Gebiets, sieht man die ersten Dattelpalmen und die Orangen im
Freien gebaut, Gewächse, die an der ligurischen Küste so geAvöhnlich
sind, während sie in Florenz und Rom nur in geschützter Lage,
in Gärten vereinzelt gezogen werden. In den Floren Toskanas und
des Kirchenstaats besteht, wie in der Lombardei, die grösste Zahl
der Gewächse aus mitteleuropäischen Formen, denen nur gewisse Bestandtheile
der immergrünen Region beigemischt sind, von welchen die
meisten auch anderswo die Grenzen des Mittelmeergebiets nordwärts
Italienisches Klima. 253
überschreiten. Erst die neapolitanische Küste wiederholt den Reichthum
der Riviera und der Provence. Aehnlich sind die Verhältnisse
an der Ostküste, am adriatischen Meer. Eine Fülle südlicher Formen
bekleidet noch das Vorgebirge Gargano in der Breite von Rom
( 4 2 N . B.), die Abruzzen, wie Rom nnd Toskana, bilden schon ein
Uebergangsgebiet znr mitteleuropäischen Vegetation des Apennins,
wo in den tieferen Lagen zwar noch immergrüne Laubhölzer und
Oliven gedeihen , aber nur wenig eigenthümliche Erzeugnisse des
Mediterranklimas und noch weniger endemische Arten gefunden
werden. Berücksichtigt man ferner, dass die Verzweigungen des
Apennins einen grossen Theil von Mittel- und Süditalien erfüllen,
und dass in diesem üebergangsgebiete die immergrüne Region, wo
sie an den Küsten auftritt, doch das Niveau von 1200 Fuss nicht zu
überschreiten s c h e i n t s o erkennt man, wie wenig Raum der Entwickelung
der Mediterranpflanzen geboten ist. Zwischen Kastanien-,
Eichen- und Buchenwäldern (1200—6000 Fuss) wiederholt sich
hier die Flora des mittlem Europas. Schon oben wurde bemerkt,
dass die Ursache dieser Erscheinung darin liege, dass in Toskana
der Sommer feuchter und der Winter kälter sei, als an der ligurischen
Küste. Jetzt aber müssen wir diesem Verhältniss näher treten
, da es nicht so einfach ist, als man bei der Vergleichung des
Klimas von Nizza und Florenz erwarten sollte. Denn in Rom, wo
noch keine wesentliche Aenderung des Vegetationscharakters von
Toskana eingetreten ist, fällt im Sommer weniger Regen, als in
Genua, und auch der Winter ist fast so milde, wie in Nizza . Bei
der Einwirkung der atmosphärischen Niederschläge auf die Vegetation
kommt es-wenig auf deren Wassermenge an, da die Bedingung
des Wachsthums schon durch ein geringfügiges Mass derselben,
wenn es ni\r den Erdboden dauernd durchfeuchtet, erfüllt wird und
nur ein kleiner Theil des die Pflanzen benetzenden Wassers wirklich
in ihr Gewebe eintritt. Daher haben die ausserordentlich grossen
Unterschiede im Regenfall, welche unter der Einwirkung der Gebirge
hervortreten, auf die Vertheilung der Pflanzen ebenso wenig Einfluss,
als die Ungleichheit verschiedener Jahre auf die Fruchtbark
e i t ^ vorausgesetzt dass nicht gewisse Grenzen der Nässe oder
Trockenheit des Erdreichs überschritten werden. Bei rasch entladeneu
Gewitterbildungen können auch im Verlauf des Sommers