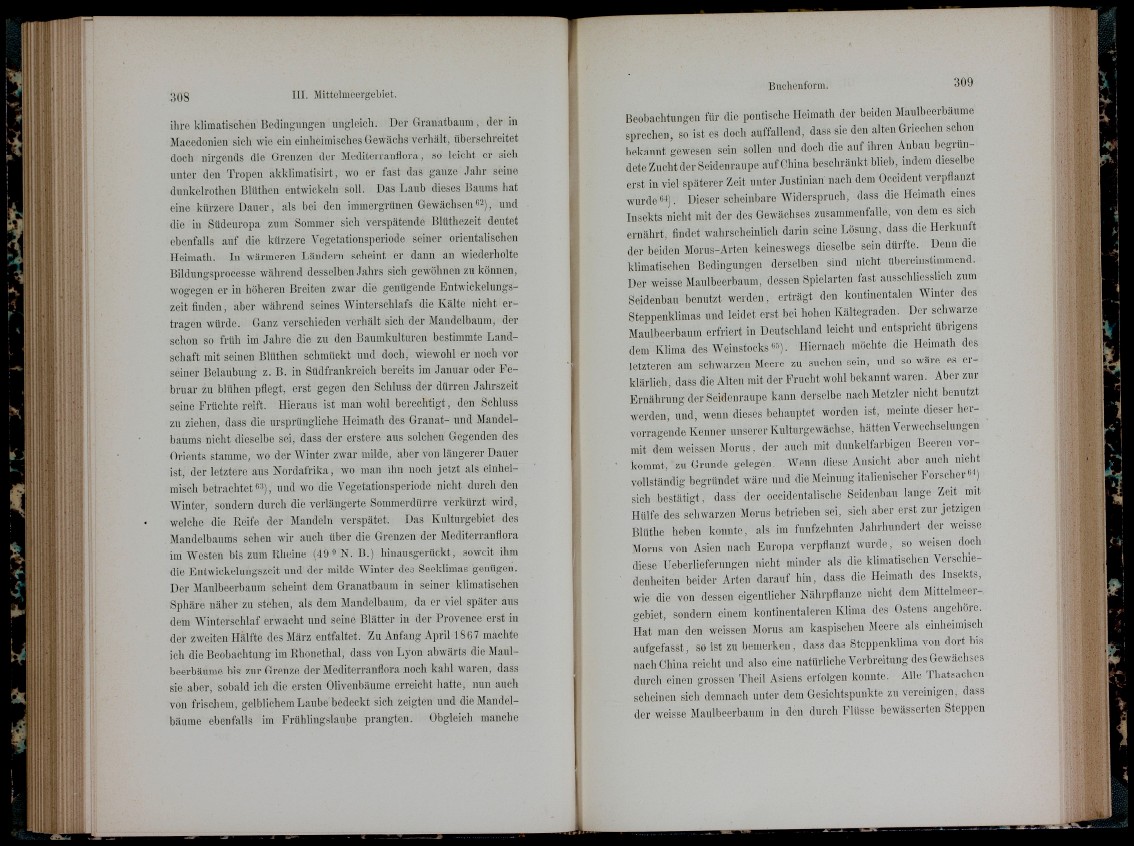
I
isl
;
. J fj
308 III. Mittelmeergebiet.
Buchenform. 309
ilire klimatisclieii Bedingungen ungleich. Der Granatbaum , der in
Macédonien sich wie ein einheimisches Gewächs verhält, überschreitet
docli nirgends die Grenzen der Mediterranflora, so leicht er sich
unter den Tropen akklimatisirt, avo er fast das ganze Jahr seine
dunkelrothen Bliithen entwickeln soll. Das Laub dieses Baums hat
eine kürzere Dauer, als bei den immergrünen Gewächsen 62)^ und
die in Südeuropa zum Sommer sich verspätende Blüthezeit deutet
ebenfalls auf die kürzere Vegetationsperiode seiner orientalischen
Heimath. In wärmeren Ländern scheint er dann an wiederholte
Bildungsprocesse während desselben Jahrs sich gewöhnen zu können,
wogegen er in höheren Breiten zwar die genügende Entwickelungszeit
finden, aber während seines Winterschlafs die Kälte nicht ertragen
würde. Ganz verschieden verhält sich der Mandelbaum, der
schon so früh im Jahre die zu den Baumkulturen bestimmte Landschaft
mit seinen Blüthen schmückt und doch, wiewohl er noch vor
seiner Belaubung z. B. in Südfrankreich bereits im Januar oder Fe -
bruar zu blühen pflegt, erst gegen den Schluss der dürren Jahrszeit
seine Früchte reift. Hieraus ist man wohl berechtigt, den Schluss
zu ziehen, dass die ursprüngliche Heimath des Granat- und Mandelbaums
nicht dieselbe sei, dass der erstere aus solchen Gegenden des
Orients stamme, wo der Winter zwar milde, aber von längerer Dauer
ist, der letztere aus Nordafrika, wo man ihn noch jetzt als einheimisch
betrachtet 63), und wo die Vegetationsperiode nicht durch den
Winter, sondern durch die verlängerte Sommerdürre verkürzt wird,
welche die Reife der Mandeln verspätet. Das Kulturgebiet des
Mandelbaums sehen wir auch über die Grenzen der Mediterranflora
im Westen bis zum Rheine (49 0N. B.) hinausgerückt, soweit ihm
die Entwickelungszeit und der milde Winter des Seeklimas genügen.
Der Maulbeerbaum scheint dem Granatbaum in seiner klimatischen
Sphäre näher zu stehen, als dem Mandelbaum, da er viel später aus
dem Winterschlaf erwacht und seine Blätter in der Provence erst in
der zweiten Hälfte des März entfaltet. Zu Anfang April 1867 machte
ich die Beobachtung im Rhonethal, dass von Lyon abwärts die Maulbeerbäume
bis zur Grenze der Mediterranflora noch kahl waren, dass
sie aber, sobald ich die ersten Olivenbäume erreicht hatte, nun auch
von frischem, gelblichem Laube bedeckt sich zeigten und dieMandelbänme
ebenfalls im Frühlingslaube prangten. Obgleich manche
Beobachtungen für die pontische Heimath der beiden Maulbeerbäume
sprechen, so ist es doch auffallend, dass sie den alten Griechen schon
bekannt gewesen sein sollen und doch die auf ihren Anbau begründete
Zucht der Seidenraupe auf China beschränkt blieb, indem dieselbe
erst in viel späterer Zeit unter Justinian nach dem Occident verpflanzt
wurdest). Dieser scheinbare Widerspruch, dass die Heimath eines
Insekts nicht mit der des Gewächses zusammenfalle, von dem es sich
ernährt, findet wahrscheinlich darin seine Lösung, dass die Herkunft
der beiden Morus-Arten keineswegs dieselbe sein dürfte. Denn die
klimatischen Bedingungen derselben sind nicht übereinstimmend.
Der weisse Maulbeerbaum, dessen Spielarten fast ausschliesslich zum
Seidenbau benutzt werden, erträgt den kontinentalen Winter des
Steppenklimas und leidet erst bei hohen Kältegraden. Der schwarze
Maulbeerbaum erfriert in Deutschland leicht und entspricht übrigens
dem Klima des W^einstocks . Hiernach möchte die Heimath des
letzteren am schwarzen Meere zu suchen sein, und so wäre es erklärlich,
dass die Alten mit der Frucht wohl bekannt waren. Aber zur
Ernährung der Seidenraupe kann derselbe nach Metzler nicht benutzt
werden, und, wenn dieses behauptet worden ist, meinte dieser hervorragende
Kenner unserer Kulturgewächse, hätten Verwechselungen
mit dem weissen Morus, der auch mit dunkelfarbigen Beeren vorkommt,
zu Grunde gelegen. Wenn diese Ansicht aber auch nicht
vollständig begründet wäre und die Meinung italienischer Forscher e^)
sich bestätigt, dass' der occidentalische Seidenbau lange Zeit mit
Hülfe des schwarzen Morus betrieben sei, sich aber erst zur jetzigen
Blüthe heben konnte, als im fünfzehnten Jahrhundert der weisse
Morus von Asien nach Europa verpflanzt wurde, so weisen doch
diese Ueberlieferungen nicht minder als die klimatischen Verschiedenheiten
beider Arten darauf hin, dass die Heimath des Insekts,
wie die von dessen eigentlicher Nährpflanze nicht dem Mittelmeergebiet,
sondern einem kontinentaleren Klima des Ostens angehöre.
Hat man den weissen Morus am kaspischen Meere als einheimisch
aufgefasst, so ist zu bemerken, dass das Steppenklima von dort bis
nach China reicht und also eine natürliche Verbreitung des Gewächses
durch einen grossen Theil Asiens erfolgen konnte. Alle Thatsachen
scheinen sich demnach unter dem Gesichtspunkte zu vereinigen, dass
der weisse Maulbeerbaum in den durch Flüsse bewässerten Steppen
., . V • >•; - X
M » ^
II
V
' 5
.(i
Si
V ''