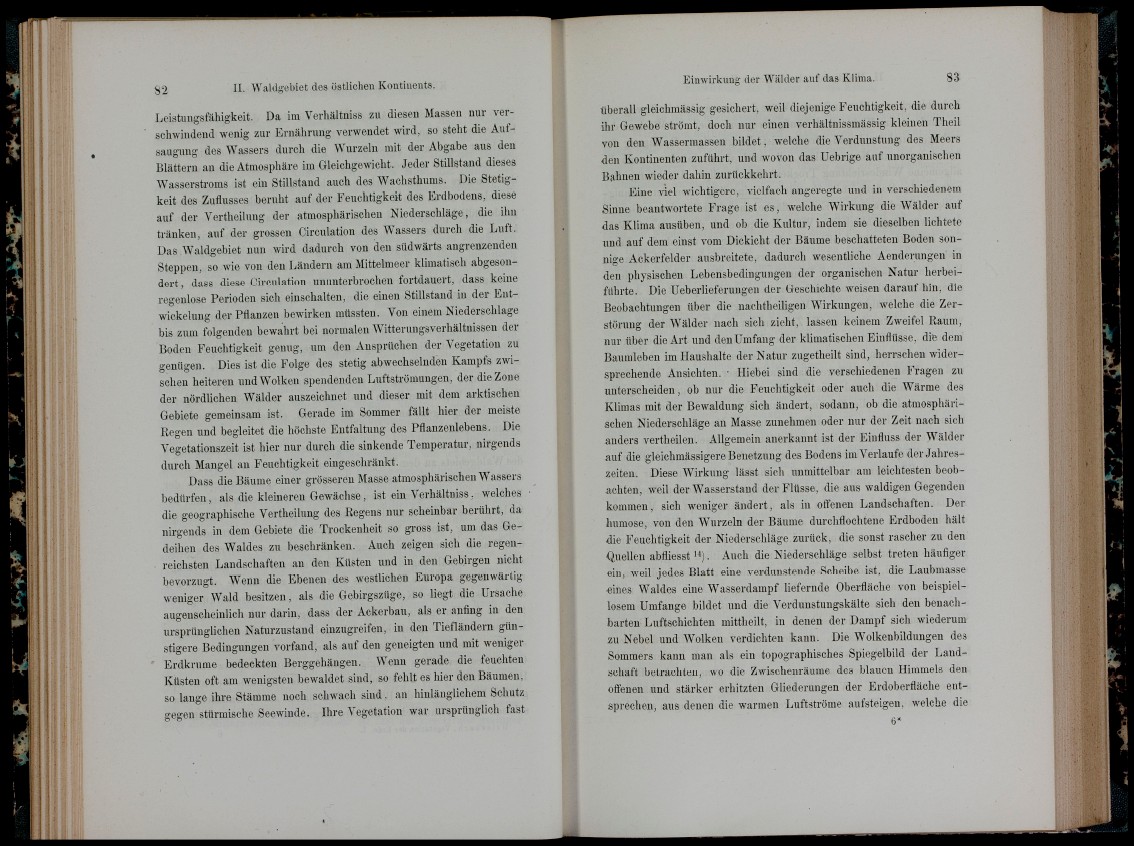
• ••í 'S
>1 -c
I ä
i
i :. 1
I -i
1 í
I'
,- 1i i
1
i " •
1 •
t ¡. ••
ñ I
A 4- ,
1 .
8 2 II. Waldgebiet des östlichen Kontinents.
Leistungsfähigkeit. Da im Verliältniss zu diesen Massen nur verschwindend
wenig zur Ernährung verwendet wird, so steht die Aufsaugung
des Wassers durch die AVurzehi mit der Abgabe aus den
Blättern an die Atmosphär e im Gleichgewicht. Jeder Stillstand dieses
Wasserstroms ist ein Stillstand auch des Wachsthums. Die Stetigkeit
des Zuflusses beruht auf der Feuchtigkeit des Erdbodens, diese
auf der Vertheilung der atmosphärischen Niederschläge, die ihn
tränken, auf der grossen Circulation des Wassers durch die Luft.
Das Waldgebiet nun wird dadurch von den südwärts angrenzenden
Steppen, so wie von den Ländern am Mittelmeer klimatisch abgesondert
, dass diese Circulation ununterbrochen fortdauert, dass keine
regenlose Perioden sich einschalten, die einen Stillstand in der Entw
i c k l u n g der Pflanzen bewirken müssten. Von einem Niederschlage
bis zum folgenden bewahrt bei normalen Witterungsverhältnissen der
Boden Feuchtigkeit genug, um den Ansprüchen der Vegetation zu
genügen. Dies ist die Folge des stetig abwechselnden Kampfs zwischen
heiteren nnd Wolken spendenden Luftströmungen, der die Zone
der nördlichen Wälder auszeichnet und dieser mit dem arktischen
Gebiete gemeinsam ist. Gerade im Sommer fällt hier der meiste
Regen und begleitet die höchste Entfaltung des Pflanzenlebens. Die
Vegetationszeit ist hier nur durch die sinkende Temperatur, nirgends
durch Mangel an Feuchtigkeit eingeschränkt.
Dass die Bäume einer grösseren Masse atmosphärischen Wassers
bedürfen, als die kleineren Gewächse, ist ein Verhältniss, welches
die geographische Vertheilung des Regens nur scheinbar berührt, da
nirgends in dem Gebiete die Trockenheit so gross ist, um das Gedeihen
des Waldes zu beschränken. Auch zeigen sich die regen-
. reichsten Landschaften an den Küsten und in den Gebirgen nicht
bevorzugt. Wenn die Ebenen des westlichen Europa gegenwärtig
weniger Wald besitzen, als die Gebirgszüge, so liegt die Ursache
augenscheinlich nur darin, dass der Ackerbau, als er anfing in den
ursprünglichen Naturzustand einzugreifen, in den Tiefländern günstigere
Bedingungen vorfand, als auf den geneigten und mit weniger
Erdkrume bedeckten Berggehängen. Wenn gerade die feuchten
Küsten oft am wenigsten bewaldet sind, so fehlt es hier den Bäumen,
so lange ihre Stämme noch schwach sind, an hinlänglichem Schutz
gegen stürmische Seewinde. Ihre Vegetation war ursprünglich fast
Einwirkung der Wälder auf das Klima. 83
überall gleichmässig gesichert, weil diejenige Feuchtigkeit, die durch
ihr Gewebe strömt, doch nur einen verhältnissmässig kleinen Theil
von den Wassermassen bildet, welche die Verdunstung des Meers
den Kontinenten zuführt, und wovon das Uebrige auf unorganischen
Bfihnen wieder dahin zurückkehrt.
Eine viel wichtigere, vielfach angeregte und in verschiedenem
Sinne beantwortete Frage ist es, welche Wirkung die Wälder auf
das Klima ausüben, und ob die Kultur, indem sie dieselben lichtete
nnd auf dem einst vom Dickicht der Bäume beschatteten Boden sonnige
Ackerfelder ausbreitete, dadurch wesentliche Aenderungen in
den physischen Lebensbedingungen der organischen Natur herbeiführte.
Die Ueberlieferungen der Geschichte weisen darauf hin, die
Beobachtungen über die nachtheiligen Wirkungen, welche die Zerstörung
der Wälder nach sich zieht, lassen keinem Zweifel Raum,
nur über die Ar t und den Umf ang der klimatischen Einflüsse, di'e dem
Banmleben im Haushalt e der Natur zugetheilt sind, herrschen widersprechende
Ansichten. • Hiebei sind die verschiedenen Fragen zu
unterscheiden, ob nur die Feuchtigkeit oder auch die Wärme des
Klimas mit der Bewaldung sich ändert, sodann, ob die atmosphärischen
Niederschläge an Masse zunehmen oder nur der Zeit nach sich
anders vertheilen. Allgemein anerkannt ist der Einfluss der Wälder
auf die gleichmässigere Benetzung des Bodens im Ver lauf e der Jahreszeiten.
Diese Wirkung lässt sich unmittelbar am leichtesten beobachten,
weil der Wasserstand der Flüsse, die aus waldigen Gegenden
kommen, sich weniger ändert, als in offenen Landschaften. Der
humóse, von den Wurzeln der Bäume durchflochtene Erdboden hält
die Feuchtigkeit der Niederschläge zurück, die sonst rascher zu den
•Quellen abfliesst i4). Auch die Niederschläge selbst treten häufiger
ein, weil jedes Blatt eine verdunstende Scheibe ist, die Laubmasse
•eines Waldes eine Wasserdampf liefernde Oberfläche von beispiellosem
Umfange bildet und die Verdunstungskälte sich den benachbarten
Luftschichten mittheilt, in denen der Dampf sich wiederum
zu Nebel und Wolken verdichten kann. Die Wolkenbildungen des
Sommers kann man als ein topographisches Spiegelbild der Landschaft
betrachten, wo die Zwischenräume des blauen Himmels den
offenen und stärker erhitzten Ghederungen der Erdoberfläche entsprechen,
aus denen die warmen Luftströme aufsteigen, welche die
•Í 1