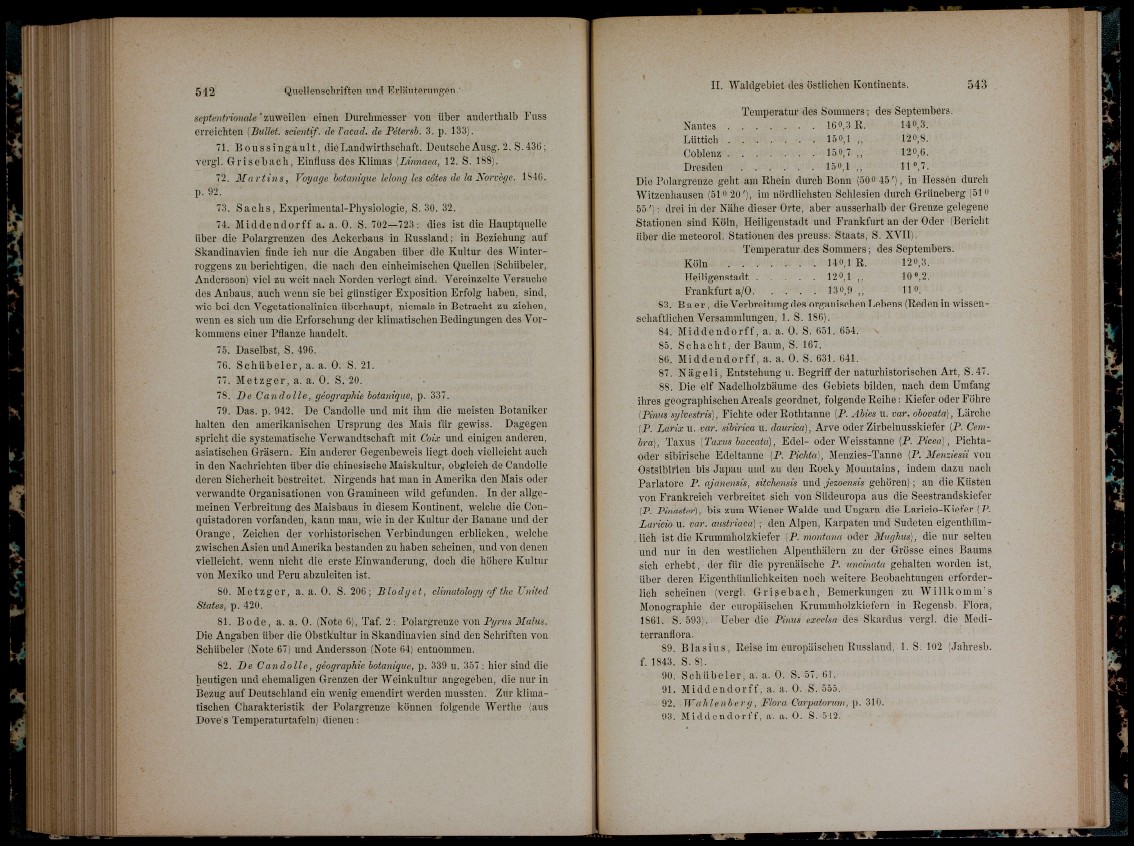
i
542 Quellenschriften xind Erläuterungen.
septe7itno7iale ^zwweilen einen Durchmesser von über anderthalb Fuss
erreichten {Btillet scientif. de Vacad. de Petersh, 3. p. 133).
71. Bous s ingaul t , dieLandwirthschaft. Deutsche Ausg. 2. S.436;
vergl. Gr i s eba ch, Einfluss des Klimas [Linnaea, 12. S. 188).
72. Martins ^ Voyage botanique lelong les côtes de la Norvège, 1846.
p. 92.
73. Sachs, Experimental-Physiologie, S. 30. 32.
74. Middendorf f a. a. 0. S. 702-723: dies ist die Hauptquelle
über die Polargrenzen des Ackerbaus in Eussland; in Beziehung auf
Skandinavien finde ich nur die Angaben über die Kultur des Winterroggens
zu berichtigen, die nach den einheimischen Quellen (Schübeier,
Andersson) viel zu weit nach Norden verlegt sind. Vereinzelte Versuche
des Anbaus, auch wenn sie bei günstiger Exposition Erfolg haben, sind,
wie bei den Vegetationslinien überhaupt, niemals in Betracht zu ziehen,
wenn es sich um die Erforschung der klimatischen Bedingungen des Vorkommens
einer Pflanze handelt.
75. Daselbst, S. 496.
76. Schübeier, a. a. 0. S. 21.
77. Metzger, a. a. 0. S. 20.
78. De Candolle, géographie botanique^ p. 337.
79. Das. p. 942. De Candolle und mit ihm die meisten Botaniker
halten den amerikanischen Ursprung des Mais für gewiss. Dagegen
spricht die systematische Verwandtschaft mit Coix und einigen anderen,
asiatischen Gräsern. Ein anderer Gegenbeweis liegt doch vielleicht auch
in den Nachrichten über die chinesische Maiskultur, obgleich de Candolle
deren Sicherheit bestreitet. Nirgends hat man in Amerika den Mais oder
verwandte Organisationen von Gramineen wild gefunden. In der allgemeinen
Verbreitung des Maisbaus in diesem Kontinent, welche die Conquistadoren
vorfanden, kann man, wie in der Kultur der Banane und der
Orange, Zeichen der vorhistorischen Verbindungen erblicken, welche
^wischen Asien xxnd Amerika bestanden zu haben scheinen, imd von denen
vielleicht, wenn nicht die erste Einwanderung, doch die höhere Kultur
von Mexiko und Peru abzuleiten ist.
80. Metzger , a. a. 0. S. 206; Bio dg et, climatology of the JJnited
States, p. 420.
81. Bode, a. a. 0. (Note 6), Taf. 2: Polargrenze von Pyrus Malus.
Die Angaben über die Obstkultur in Skandinavien sind den Schriften von
SchUbeler (Note 67) und Andersson (Note 64) entnommen.
82. De Candolle, géographie botanique, p. 339 u. 357 : hier sind die
heutigen und ehemaligen Grenzen der Weinkultur angegeben, die nur in
Bezug auf Deutschland ein wenig emendirt werden mussten. Zur klimatischen
Charakteristik der Polargrenze können folgende Werthe (aus
Dove's Temperaturtafeln) dienen :
IL Waldgebiet des östlichen Kontinents.
Temperatur des Sommers; des Septembers.
140,3.
120,8.
120,6.
110,7.
, in Hessen durch
Nantes 160,3K.
Lüttich 15 0,1 „
Coblenz 150,7 ,,
Dresden 150,l ,,
Die Polargrenze geht am Rhein durch Bonn (50 o 45';
Witzenhausen (51 o 2 0 i m nördlichsten Schlesien durch Grüneberg (51 o
55'): drei in der Nähe dieser Orte, aber ausserhalb der Grenze gelegene
Stationen sind Köln, Heiligenstadt und Frankfurt an der Oder (Bericht
über die meteorol. Stationen des preuss. Staats, S. XVII).
Temperatur des Sommers; des Septembers.
Köln 140,1 R. 120,3.
Heiligenstadt 120,i ,, 10^,2.
Frankfurt a/0 130,9 ,, 11 o.
83. B a e r, die Verbreitung des organischen Lebens (Reden in wissenschaftlichen
Versammlitngen, 1. S. 186).
84. Middendor f f , a. a. 0. S. 651. 654.
85. Schacht , der Baum, S. 167.
86. Middendor f f , a. a. 0. S. 631. 641.
87. Nägel i , Entstehung u. BegriiF der naturhistorischen Art, S.47.
88. Die elf Nadelhokbäume des Gebiets bilden, nach dem Umfang
ihres geographischen Areals geordnet, folgende Reihe: Kiefer oder Föhre
[Tinm sylvestris), Fichte oder Rothtanne (P. Abies u. var. obovata), Lärche
(P. Larix u. mr, sibirica u. daurica), Arve oder Zirbelnusskiefer (P. Cer)ihra),
Taxus [Taxus baccata), Edel- oder Weisstanne [P, Picea), Pichtaoder
sibirische Edeltanne (P. Piehta), Menzies-Tanne (P. Menziesii von
Ostsibirien bis Japan und zu den Rocky Mountains, indem dazu nach
Pariatore P ajanensis, sitchensis imd jezoensis gehören); an die Küsten
von Frankreich verbreitet sich von Südeuropa aus die Seestrandskiefer
(P Pinaster), bis zum Wiener Walde und Ungarn die Laricio-Kiefer (P,
Laricio u. var, austriaca) ; den Alpen, Karpaten und Sudeten eigenthümiich
ist die Krummholzkiefer (P. montana oder Mughus), die nur selten
und nur in den westlichen Alpenthälern zu der Grösse eines Baums
sich erhebt, der für die pyrenäische P uncinata gehalten worden ist,
über deren Eigenthümlichkeiten noch weitere Beobachtungen erforderlich
scheinen (vergl. Grisebach, Bemerkungen zu Willkomm's
Monographie der europäischen Krummholzkiefern in Regensb. Flora,
3861. S. 593). Ueber die Püms excelsa des Skardus vergl. die Mediterranflora.
89. Blasius, Reise im exu'opäischen Eussland, 1. S. 102 (Jahresb.
f. 1843. S. 8).
90. Schübeier, a. a. 0. S- 57. 61.
91. Middendor f f , a. a. 0. S. 555.
92. Wahlenberg, Flora Carpatorum, p. 310.
93. Middendor f f , a. a. 0. S. 542.
4-