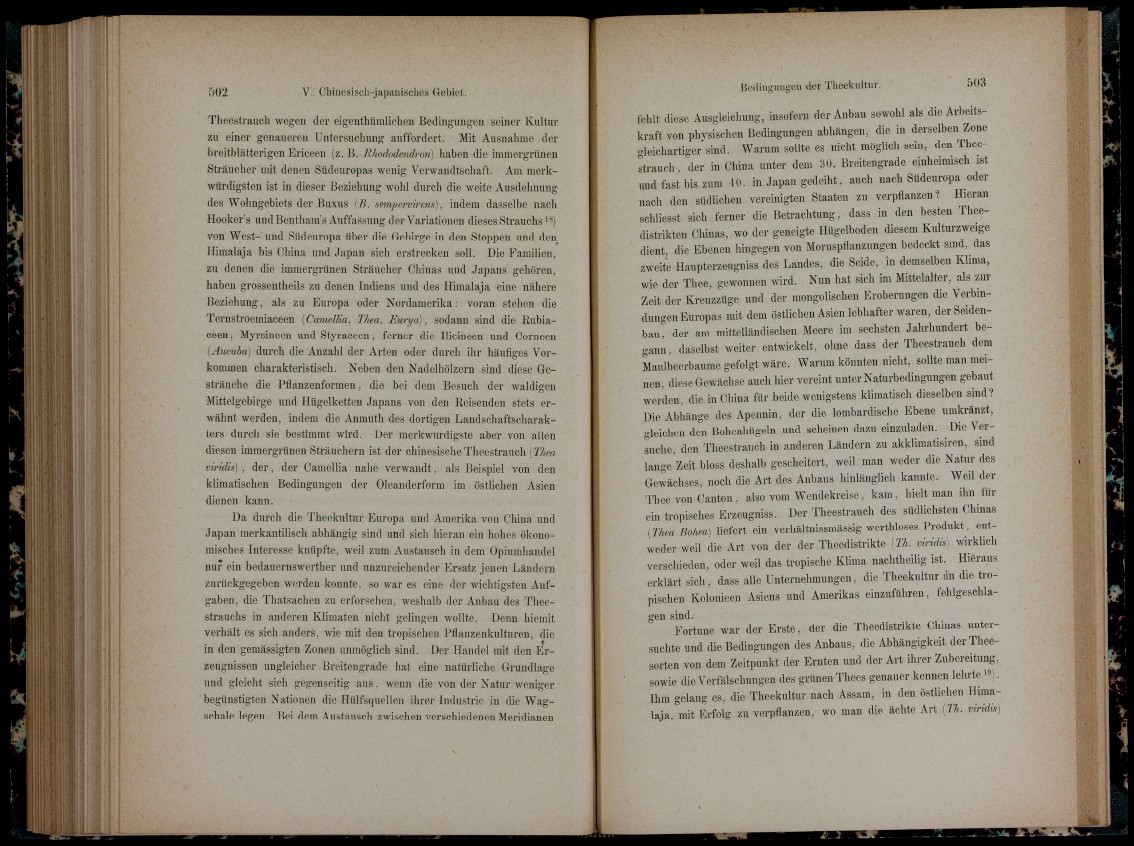
m
502 V. Cliiiiosisch-japauisches Gebiet.
Tlieestraucli wegen der eigenthümlichen Bedingungen seiner Kultur
zu einer genaueren Untersuchung auffordert. Mit Ausnahme der
breitblätterigen Ericeen (z. B. Rhododendron) haben die immergrünen
Sträucher mit denen Südeuropas wenig Verwandtschaft. Am merkwürdigsten
ist in dieser Beziehung wohl durch die weite Ausdehnung
des Wohngebiets der Buxus ( B. sempei^virens), indem dasselbe nach
Hooker's und Bentham's Auffassung der Variationen dieses Strauchs
von West- und Südeuropa über die Gebirge in den Steppen und den
Himalaja bis China und Japan sich erstrecken soll. Die Familien,
zu denen die immergrünen Sträucher Chinas und Japans gehören,
haben grossentheils zu denen Indiens und des Himalaja eine nähere
Beziehung, als zu Europa oder Nordamerika: voran stehen die
Ternstroemiaceen {CamelUa, Thea, Eurya), sodann sind die Rubiaceen,
Myrsineen und Styraceen, ferner die Ilicineen und Corneen
[Auciiba) durch die Anzahl der Arten oder durch ihr häufiges Vorkommen
charakteristisch. Neben den Nadelhölzern sind diese Gesträuche
die Pflanzenformen, die bei dem Besuch der waldigen
Mittelgebirge und Hügelketten Japans von den Reisenden stets erwähnt
werden, indem die Anmuth des dortigen Landschaftscharakters
durch sie bestimmt wird. Der merkwürdigste aber von allen
diesen immergrünen Sträuchern ist der chinesische Theestrauch [Thea
inridis) , der, der Camellia nahe verwandt, als Beispiel von den
klimatischen Bedingungen der Oleanderform im östlichen Asien
dienen kann.
Da durch die Theekultur Europa und Amerika von China und
Japan merkantilisch abhängig sind und sich hieran ein hohes ökonomisches
Interesse knüpfte, weil zum Austausch in dem Opiumhandel
nur ein bedauernswerther und unzureichender Ersatz jenen Ländern
zurückgegeben werden konnte, so war es eine der wichtigsten Aufgaben,
die Thatsachen zu erforschen, weshalb der Anbau des Theestrauchs
in anderen Klimaten nicht gelingen wollte. Denn hiemit
verhält es sich anders, wie mit den tropischen Pflanzenkulturen, die
in den gemässigten Zonen unmöglich sind. Der Handel mit den Erzeugnissen
ungleicher Breitengrade hat eine natürliche Grundlage
nnd gleicht sich gegenseitig aus, wenn die von der Natur weniger
begünstigten Nationen die Hülfsquellen ihrer Industrie in die Wagschale
legen. Bei dem Austausch zwischen verschiedenen Meridianen
Bedingungen der Theekultur. 503
fehlt diese Ausgleichung, insofern der Anbau sowohl als die Arbeitskraft
von physischen Bedingungen abhängen, die in derselben Zone
gleichartiger sind. Warum sollte es nicht möglich sein, den Theestrauch
der in China unter dem 30. Breitengrade einheimisch ist
und fast bis zum 40. in Japan gedeiht, auch nach Südeuropa oder
nach den südlichen vereinigten Staaten zu verpflanzen? Hieran
schliesst sich ferner die Betrachtung, dass in den besten Theedistrikten
Chinas, wo der geneigte Hügelboden diesem Kulturzweige
dient, die Ebenen hingegen von Moruspflanzungen bedeckt sind, das
zweite Haupterzeugniss des Landes, die Seide, in demselben Klima,
wie der Thee, gewonnen wird. Nun hat sich im Mittelalter, als zur
Zeit der Kreuzzüge und der mongolischen Eroberungen die Verbindungen
Europas mit dem östlichen Asien lebhafter waren, der Seidenbau
der am mittelländischen Meere im sechsten Jahrhundert begann
, daselbst weiter entwickelt, ohne dass der Theestrauch dem
Maulbeerbaume gefolgt wäre. Warum könnten nicht, sollte man meinen,
diese Gewächse auch hier vereint unter Naturbedingungen gebaut
werden, die in China für beide wenigstens klimatisch dieselben sind?
Die Abhänge des Apennin, der die lombardische Ebene umkränzt,
gleichen den Boheahügeln und scheinen dazu einzuladen. Die Versuche,
den Theestrauch in anderen Ländern zu akklimatisiren, sind
lange Zeit bloss deshalb gescheitert, weil man weder die Natur des
Gewächses, noch die Art des Anbaus hinlänglich kannte. Weil der
Thee von Canton, also vom Wendekreise, kam, hielt man ihn für
ein tropisches Erzeugniss. Der Theestrauch des südlichsten Chinas
[Thea Bohea) liefert ein verhältnissmässig werthloses Produkt, entweder
weil die Art von der der Theedistrikte [Th. viridis) wirklich
verschieden, oder weil das tropische Klima nachtheilig ist. Hieraus
erklärt sich, dass alle Unternehmungen, die Theekultur ¡in die tropischen
Kolonieen Asiens und Amerikas einzuführen, fehlgeschlagen
sind.
Fortune war der Erste, der die Theedistrikte Chinas untersuchte
und die Bedingungen des Anbaus, die Abhängigkeit derTheesorten
von dem Zeitpunkt der Ernten und der Art ihrer Zubereitung,
sowie die Verfälschungen des grünen Thees genauer kennen lehrte i«).
Ihm gelang es, die Theekultur nach Assam, in den östlichen Himalaja,
mit Erfolg zu verpflanzen, wo man die ächte Art {Th. viridis)
4 f
\