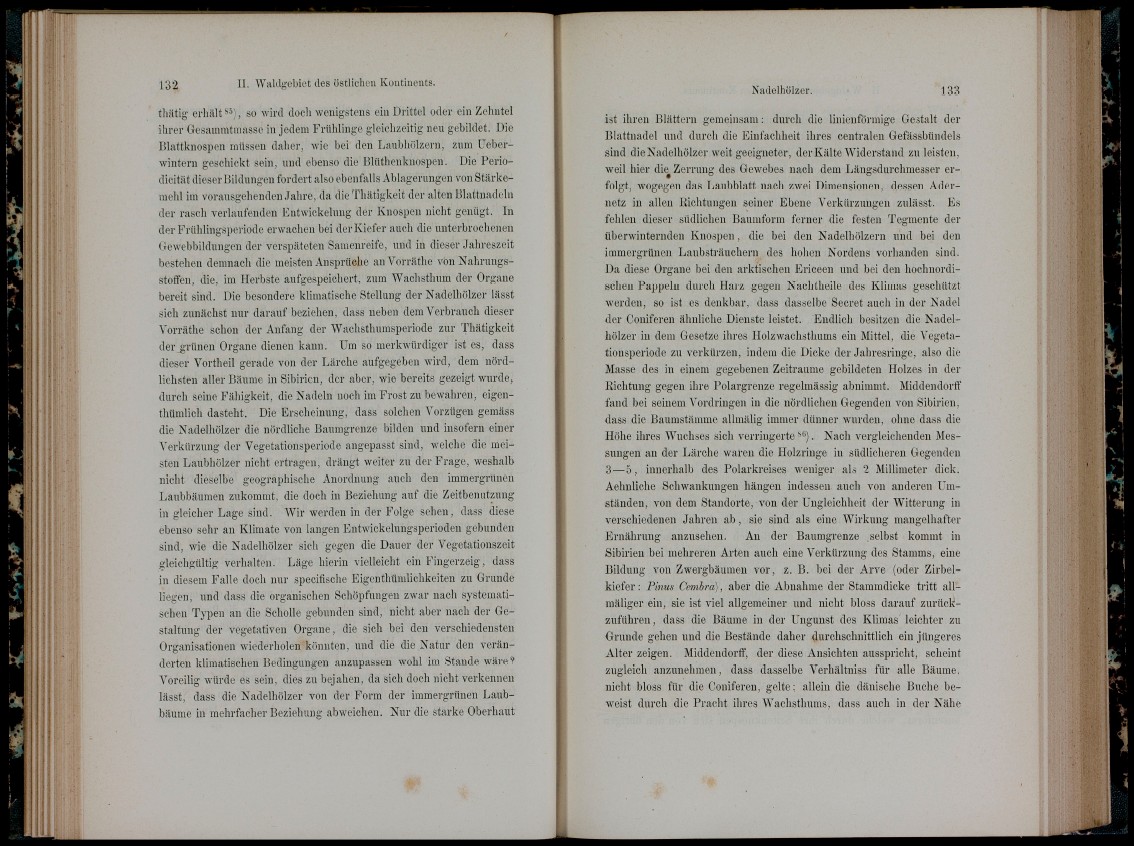
132 IL Waklgebiet des östlichen Kontinents.
i
i i
I
j
I [
I
1' -
i i
! rI :
iI;. .i.
tluitig erhältst), so wird doch wenigstens ein Drittel oder ein Zehntel
ihrer Gesainmtmasse in jedem Frühlinge gleichzeitig nen gebildet. Die
Blattknospen müssen daher, wie bei den Lanbhölzern, znm üeberwintern
geschickt sein, und ebenso die Blüthenknospen. Die Periodicität
dieser Bildungen fordert also ebenfalls Ablagerungen von Stärkemehl
im vorausgehenden Jahre, da die Thätigkeit der alten Blattnadeln
der rasch verlaufenden Entwickelung der Knospen nicht genügt. In
der Frühlingsperiode erwachen bei der Kiefer auch die unterbrochenen
Gewebbildungen der verspäteten Samenreife, und in dieser Jahreszeit
bestehen demnach die meisten Ansprüche anVorräthe von Nahrungsstoifen,
die, im Herbste aufgespeichert, zum Wachsthum der Organe
bereit sind. Die besondere klimatische Stellung der Nadelhölzer lässt
sich zunächst nur darauf beziehen, dass neben dem Verbrauch dieser
Vorräthe schon der Anfang der Wachstliumsperiode zur Thätigkeit
der_gTünen Organe dienen kann. Um so merkwürdiger ist es, dass
dieser Vortheil gerade von der Lärche aufgegeben wird, dem nördlichsten
aller Bäume in Sibirien, der aber, wie bereits gezeigt wurde,
durch seine Fähigkeit, die Nadeln noch im Frost zu bewahren, eigenthümlich
dasteht. Die Erscheinung, dass solchen Vorzügen gemäss
die Nadelhölzer die nördliche Baumgrenze bilden und insofern einer
Verkürzung der Vegetationsperiode angepasst sind, welche die meisten
Laubhölzer nicht ertragen, drängt weiter zu der Frage, weshalb
nicht dieselbe geographische Anordnung auch den immergrünen
Laubbäumen zukommt, die doch in Beziehung auf die Zeitbenutzung
in gleicher Lage sind. Wir werden in der Folge sehen, dass diese
ebenso sehr an Klimate von langen Entwickelungsperioden gebunden
sind, wie die Nadelhölzer sich gegen die Dauer der Vegetationszeit
gleichgültig verhalten. Läge hierin vielleicht ein Fingerzeig, dass
in diesem Falle doch nur specifisclie Eigenthümlichkeiten zu Grunde
liegen, und dass die organischen Schöpfungen zwar nach systematischen
Typen an die Scholle gebunden sind, nicht aber nach der Gestaltung
der vegetativen Organe, die sich bei den verschiedensten
Organisationen wiederholen könnten, und die die Natur den veränderten
klimatischen Bedingungen anzupassen wohl im Stande wäre?
Voreilig würde es sein, dies zu bejahen, da sich doch nicht verkennen
lässt, dass die Nadelhölzer von der Form der immergrünen Laubbäume
in mehrfacher Beziehung abweichen. Nur die starke Oberhaut
Nadelhölzer. 133
ist ihren Blättern gemeinsam: durch die linienförmige Gestalt der
Blattnadel und durch die Einfachheit ihres centralen Gefässbündels
sind die Nadelhölzer weit geeigneter, der Kälte Widerstand zu leisten,
weil hier die Zerrung des Gewebes nach dem Längsdurchniesser erfolgt,
wogegen das Laubblatt nach zwei Dimensionen^ dessen Adernetz
in allen Richtungen seiner Ebene Verkürzungen zulässt. Es
fehlen dieser südlichen Baumform ferner die festen Tegmente der
überwinternden Knospen, die bei den Nadelhölzern und bei den
immergrünen Laubsträuchern des holien Nordens vorhanden sind.
Da diese Organe bei den arktischen Ericeen und bei den hochnordischen
Pappeln durch Harz gegen Nachtheile des Klimas geschützt
werden, so ist es denkbar, dass dasselbe Secret auch in der Nadel
der Coniferen ähnliche Dienste leistet. Endlich besitzen die Nadelhölzer
in dem Gesetze ihres Holzwachsthums ein Mittel, die Vegetationsperiode
zu verkürzen, indem die Dicke der Jahresringe, also die
Masse des in einem gegebenen Zeiträume gebildeten Holzes in der
Richtung gegen ihre Polargrenze regelmässig abnimmt. Middendorff
fand bei seinem Vordringen in die nördlichen Gegenden von Sibirien,
dass die Baumstämme allmälig immer dünner wurden, ohne dass die
Höhe ihres Wuchses sich verringerte . Nach vergleichenden Messungen
an der Lärche waren die Holzringe in südlicheren Gegenden
3—5, innerhalb des Polarkreises weniger als 2 Millimeter dick.
Aehnliche Schwankungen hängen indessen auch von anderen Umständen,
von dem Standorte, von der Ungleichheit der Witterung in
verschiedenen Jahren ab, sie sind als eine Wirkung mangelhafter
Ernährung anzusehen. An der Baumgrenze .selbst kommt in
Sibirien bei mehreren Arten auch eine Verkürzung des Stamms, eine
Bildung von Zwergbäumen vor, z. B. bei der Arve (oder Zirbelkiefer
: Pinns Cembra), aber die Abnahme der Stammdicke tritt allmäliger
ein, sie ist viel allgemeiner und nicht bloss darauf zurückzuführen,
dass die Bäume in der Ungunst des Klimas leichter zu
Grunde gehen und die Bestände daher durchschnittlich ein jüngeres
Alter zeigen. Middendorff, der diese Ansichten ausspricht, scheint
zugleich anzunehmen, dass dasselbe Verhältniss für alle Bäume,
nicht bloss für die Coniferen, gelte; allein die d-änische Buche beweist
durch die Pracht ihres Wachsthums, dass auch in der Nähe