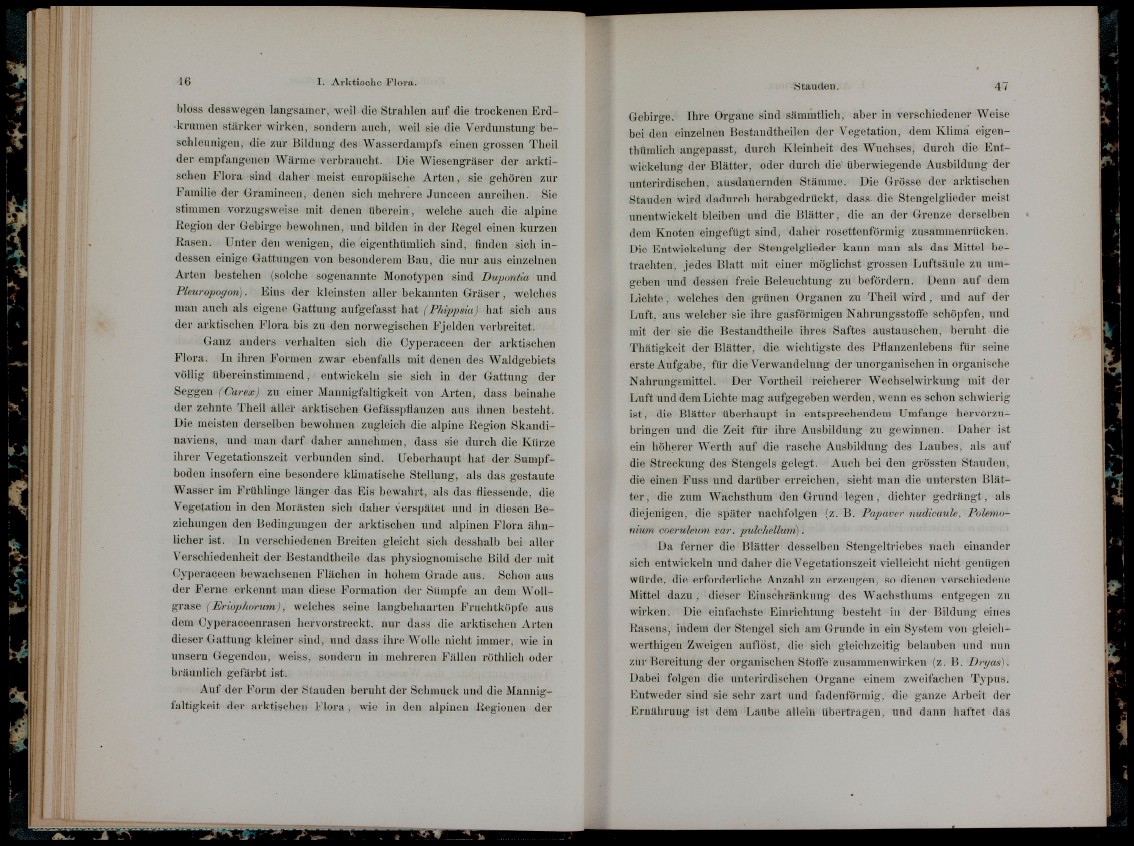
46 I. Arktische Plora. Stauden, 47
: -
i
. . .
M
bloss desswegen langsamer, weil die Strahlen auf die trockenen Erd-
.krumen stärker wirken, sondern auch, weil sie die Verdunstung beschleunigen,
die zur Bildung des Wasserdampfs einen grossen Theil
der empfangenen Wärme verbraucht. Die Wiesengräser der arktischen
Flora sind daher meist europäische Arten, sie gehören zur
Familie der Gramineen, denen sich mehrere Junceen anreihen. Sie
stimmen vorzugsweise mit denen überein, welche auch die alpine
ßegion der Gebirge bewohnen, und bilden in der Regel einen kurzen
Rasen. Unter den wenigen, die eigenthümlich sind, finden sich indessen
einige Gattungen von besonderem Bau, die nur aus einzelnen
Arten bestehen (solche sogenannte Monotypen sind Bupontia und
Pleurojjogon). Ems der kleinsten aller bekannten Gräser, welches
man auch als eigene Gattung aufgefasst hat (Phippsia) hat sich aus
der arktischen Flora bis zu den norwegischen Fjelden verbreitet.
Ganz anders verhalten sich die Cyperaceen der arktischen
Flora. In ihren Formen zwar ebenfalls mit denen des Waldgebiets
völlig übereinstimmend, entwickeln sie sich in der Gattung der
Seggen (Carex) zu einer Mannigfaltigkeit von Arten, dass beinahe
der zehnte Theil aller arktischen Gefässpflanzen aus ihnen besteht.
Die meisten derselben bewohnen zugleich die alpine Region Skandinaviens,
und man darf daher annehmen, dass sie durch die Kürze
ihrer Vegetationszeit verbunden sind, üeberhaupt hat der Sumpfboden
insofern eine besondere klimatische Stellung, als das gestaute
Wasser im Frühlinge länger das Eis bewahrt, als das fliessende, die
Vegetation in den Morästen sich daher verspätet und in diesen Beziehungen
den Bedingungen der arktischen und alpinen Flora ähnlicher
ist. In verschiedenen Breiten gleicht sich desshalb bei aller
Verschiedenheit der Bestandtheile das physiognomische Bild der mit
Cyperaceen bewachsenen Flächen in hohem Grade aus. Schon aus
der Ferne erkennt man diese Formation der Sümpfe an dem Wollgrase
(Eriophorum), welches seine langbehaarten Fruchtköpfe aus
dem Cyperaceenrasen hervorstreckt, nur dass die arktischen Arten
dieser Gattung kleiner sind, und dass ihre Wolle nicht immer, wie in
unsern Gegenden, weiss, sondern in mehreren Fällen röthlich oder
bräunlich gefärbt ist.
Auf der Form der Stauden beruht der Schmuck und die Mannigfaltigkeit
der arktischen Flora, wie in den alpinen Regionen der
Gebirge. Ihre Organe sind sämmtlich, aber in verschiedener Weise
bei den einzelnen Bestandtheilen der Vegetation, dem Klima eigenthümlich
angepasst, durch Kleinheit des Wuchses, durch die Ent-
Wickelung der Blätter, oder durch die" überwiegende Ausbildung der
unterirdischen, ausdauernden Stämme. Die Grösse der arktischen
Stauden wird dadurch herabgedrückt, dass die Stengelglieder meist
unentwickelt bleiben und die Blätter, die an der Grenze derselben
dem Knoten eingefügt sind, daher rosettenförmig zusammenrücken.
Die Entwickelung der Stengelgliader kann man als das Mittel betrachten,
jedes Blatt mit einer möglichst grossen Luftsäule zu umgeben
und dessen freie Beleuchtung zu befördern. Denn auf dem
Lichte, welches den grünen Organen zu Theil wird, und auf der
Luft, aus welcher sie ihre gasförmigen Nahrungsstoffe schöpfen, und
mit der sie die Bestandtheile ihres Saftes austauschen, beruht die
Thätigkeit der Blätter, die. wichtigste des Pflanzenlebens für seine
erste Aufgabe, für die Verwandelung der unorganischen in organische
Nahrungsmittel. Der Vortheil reicherer Wechselwirkung mit der
Luft und dem Lichte mag aufgegeben werden, wenn es schon schwierig
ist, die Blätter überhaupt in entsprechendem Umfange hervorzubringen
und die Zeit für ihre Ausbildung zu gewinnen. Daher ist
ein höherer Werth auf die rasche Ausbildung des Laubes, als auf
die Streckung des Stengels gelegt. Auch bei den grössten Stauden,
die einen Fuss und darüber erreichen, sieht man die untersten Blätter,
die zum Wachsthum den Grund legen, dichter gedrängt, als
diejenigen, die später nachfolgen (z. B. Papavei^ niidicaule, Polemonium
coeruleiim var, pulchellum).
Da ferner die Blätter desselben Stengeltriebes nach einander
sich entwickeln und daher die Vegetationszeit vielleicht nicht genügen
würde, die erforderliche Anzahl zu erzeugen, so dienen verschiedene
Mittel dazu, dieser Einschränkung des Wachsthums entgegen zu
wirken. Die einfachste Einrichtung besteht in der Bildung eines
Rasens, indem der Stengel sich am Grunde in ein System von gleichwerthigen
Zweigen auflöst, die sich gleichzeitig belauben und nun
zur Bereitung der organischen Stoffe zusammenwirken (z.B. Dryas).
Dabei folgen die unterirdischen Organe einem zweifachen Typus.
Entweder sind sie sehr zart und fadenförmig, die ganze Arbeit der
Ernährung ist dem Laube allein übertragen, und dann haftet das
ü; S