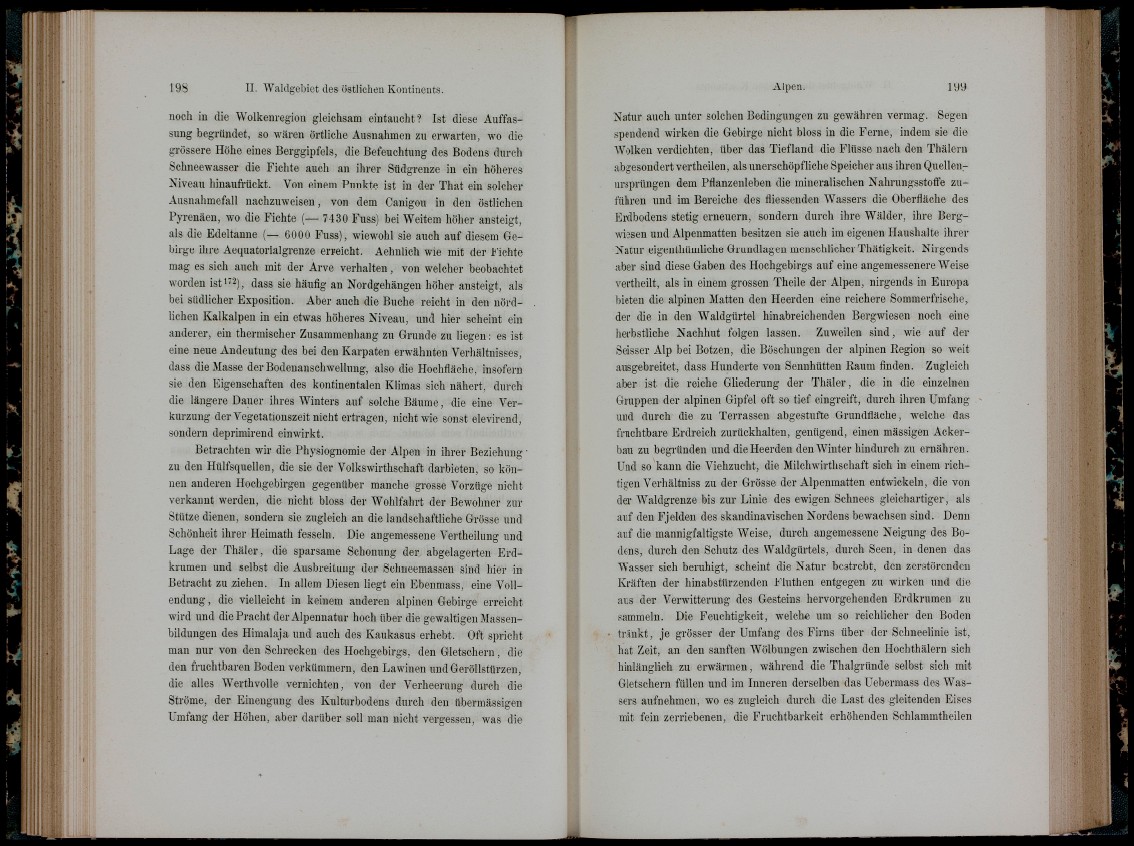
L i
ii t 1
198 IL Waldgebiet des östlichen Kontinents. Alpen. 199
viv •• I , •
:
noch in die Wolkenregion gleichsam eintaucht? Ist diese Auffassung
begründet, so wären örtliche Ausnahmen zu erwarten, wo die
grössere Höhe eines Berggipfels, die Befeuchtung des Bodens durch
Schneewasser die Fichte auch an ihrer Südgrenze in ein höheres
Niveau hinaufrückt. Von einem Punkte ist in der That ein solcher
Ausnahmefall nachzuweisen, von dem Canigou in den östlichen
Pyrenäen, wo die Fichte (— 7430 Fuss) bei Weitem höher ansteigt,
als die Edeltanne (— 6000 Fuss), wiewohl sie auch auf diesem Gebirge
ihre Aequatorialgrenze erreicht. Aehnlich wie mit der Fichte
mag es sich auch mit der Arve verhalten, von welcher beobachtet
worden ist^'^^)^ ¿^ss sie häufig an Nordgehängen höher ansteigt, als
bei südlicher Exposition. Aber auch die Buche reicht in den nördlichen
Kalkalpen in ein etwas höheres Niveau, und hier scheint ein
anderer, ein thermischer Zusammenhang zu Grunde zu liegen: es ist
eine neue Andeutung des bei den Karpaten erwähnten Verhältnisses,
dass die Masse der Bodenanschwellung, also die Hochfläche, insofern
sie den Eigenschaften des kontinentalen Klimas sich nähert, durch
die längere Dauer ihres Winters auf solche Bäume, die eine Verkürzung
derVegetationszeit nicht ertragen, nicht wie sonst elevirend,
sondern deprimirend einwirkt.
Betrachten wir die Physiognomie der Alpen in ihrer Beziehung
zu den Hülfsquellen, die sie der Volkswirthschaft darbieten, so können
anderen Hochgebirgen gegenüber manche grosse Vorzüge nicht
verkannt werden, die nicht bloss der Wohlfahrt der Bewohner zur
Stütze dienen, sondern sie zugleich an die landschaftliche Grösse und
Schönheit ihrer Heimath fesseln. Die angemessene Vertheilung und
Lage der Thäler, die sparsame Schonung der abgelagerten Erdkrumen
und selbst die Ausbreitung der Schneemassen sind hier in
Betracht zu ziehen. In allem Diesen liegt ein Ebenmass, eine Vollendung
, die vielleicht in keinem anderen alpinen Gebirge erreicht
wird und die Pracht der Alpennatur hoch über die gewaltigen Massenbildungen
des Himalaja und auch des Kaukasus erhebt. Oft spricht
man nur von den Schrecken des Hochgebirgs, den Gletschern, die
den fruchtbaren Boden verkümmern, den Lawinen und Geröllstürzen,
die alles Werthvolle vernichten, von der Verheerung durch die
Ströme, der Einengung des Kulturbodens durch den übermässigen
Umfang der Höhen, aber darüber soll man nicht vergessen, was die
Natur auch unter solchen Bedingungen zu gewähren vermag. Segen
spendend wirken die Gebirge nicht bloss in die Ferne, indem sie die
Wolken verdichten, über das Tiefland die Flüsse nach den Thälern
abgesondert vertheilen, als unerschöpfliche Speicher aus ihren Quellenr
Ursprüngen dem Pflanzenleben die mineralischen Nahrungsstoffe zuführen
und im Bereiche des fliessenden Wassers die Oberfläche des
Erdbodens stetig erneuern, sondern durch ihre Wälder, ihre Bergwiesen
und Alpenmatten besitzen sie auch im eigenen Haushalte ihrer
Natur eigenthümliche Grundlagen menschlicher Thätigkeit. Nirgends
aber sind diese Gaben des Hochgebirgs auf eine angemessenere Weise
vertheilt, als in einem grossen Theile der Alpen, nirgends in Europa
bieten die alpinen Matten den Heerden eine reichere Sommerfrische,
der die in den Waldgürtel hinabreichenden Bergwiesen noch eine
herbstliche Nachhut folgen lassen. Zuweilen sind, wie auf der
Seisser Alp bei Bötzen, die Böschungen der alpinen Kegion so weit
ausgebreitet, dass Hunderte von Sennhütten Raum finden. Zugleich
aber ist die reiche Gliederung der Thäler, die in die einzelnen
Gruppen der alpinen Gipfel oft so tief eingreift, durch ihren Umfang
und durch die zu Terrassen abgestufte Grundfläche, welche das
fruchtbare Erdreich zurückhalten, genügend, einen mässigen Ackerbau
zu begründen und die Heerden den Winter hindurch zu ernähren.
Und so'kann die Viehzucht, die Milchwirthschaft sich in einem richtigen
Verhältniss zu der Grösse der Alpenmatten entwickeln, die von
der Waldgrenze bis zur Linie des ewigen Schnees gleichartiger, als
auf den Fjelden des skandinavischen Nordens bewachsen sind. Denn
auf die mannigfaltigste Weise, durch angemessene Neigung des Bodens,
durch den Schutz des Waldgürtels, durch Seen, in denen das
Wasser sich beruhigt, scheint die Natur bestrebt, den zerstörenden
Kräften der hinabstürzenden Finthen entgegen zu wirken und die
aus der Verwitterung des Gesteins hervorgehenden Erdkrumen zu
sammeln. Die Feuchtigkeit, welche um so reichlicher den Boden
tränkt, je grösser der Umfang des Firns über der Schneelinie ist,
hat Zeit, an den sanften Wölbungen zwischen den Hochthälern sich
hinlänglich zu erwärmen, während die Thalgründe selbst sich mit
Gletschern füllen und im Inneren derselben das Uebermass des Wassers
aufnehmen, wo es zugleich durch die Last des gleitenden Eises
mit fein zerriebenen, die Fruchtbarkeit erhöhenden Schlammtheilen