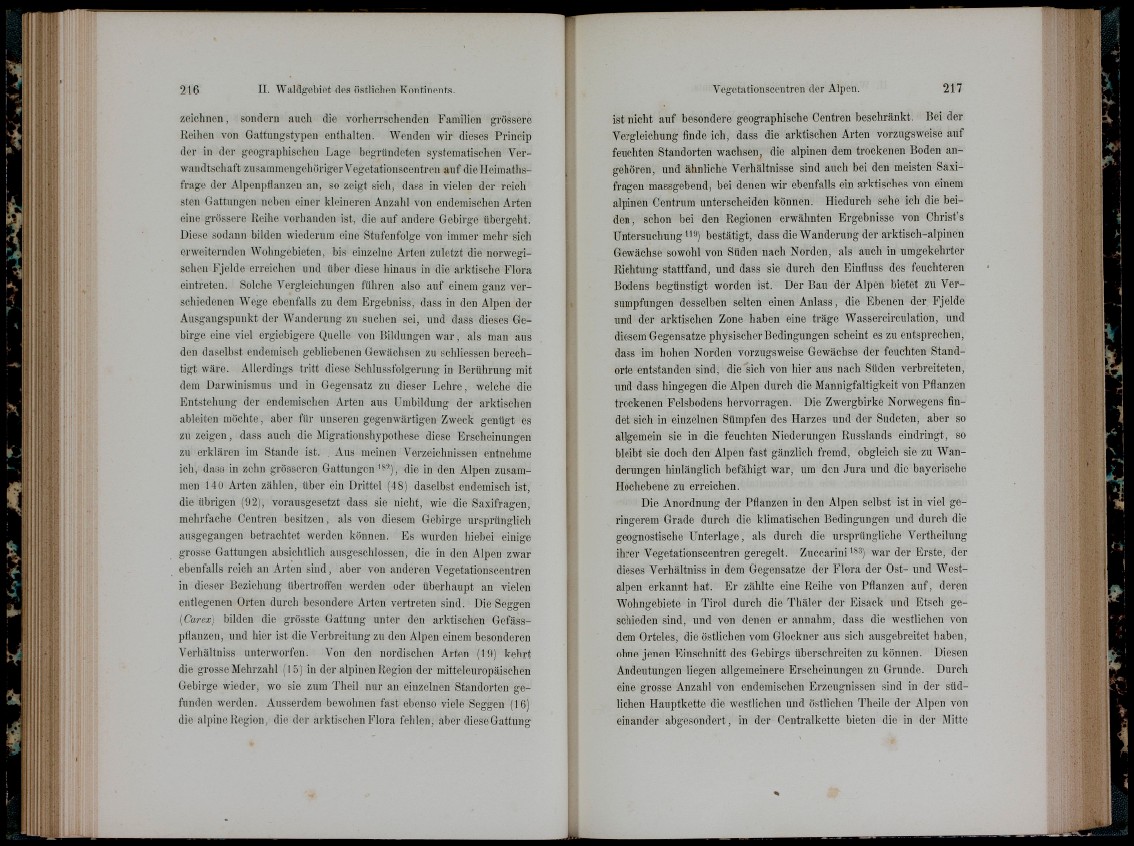
I r
iii
I:
S : - • •
ti:
t;
-
1 •
i}l
216 II. Waldgebiet des östlichen Kontinents.
zeichnen, sondern anch die vorherrschenden Familien grössere
Reilien von Gattnngstypen enthalten. Wenden wir dieses Princip
der in der geographischen Lage begründeten systematischen Verwandtschaft
znsaramengehöriger Vegetationscentren auf dieileimathsfrage
der Alpenpflanzen an, so zeigt sich, dass in vielen der reichsten
Gattungen neben einer kleineren Anzahl von endemischen Arten
eine grössere Reihe vorhanden ist, die anf andere Gebirge übergeht.
Diese sodann bilden wiedernra eine Stufenfolge von immer mehr sich
erweiternden Wohngebieten, bis einzelne Arten zuletzt die norwegischen
Fjelde erreichen nnd über diese hinans in die arktische Flora
eintreten. Solche Vergleichungen führen also anf einem ganz verschiedenen
Wege ebenfalls zn dem Ergebniss, dass in den Alpen der
Ausgangspunkt der Wanderung zn suchen sei, und dass dieses Gebirge
eine viel ergiebigere Quelle von Bildungen war, als man aus
den daselbst endemisch gebliebenen Gewächsen zu schliessen berechtigt
wäre. Allerdings tritt diese Schlnssfolgerung in Berührnng mit
dem Darwinismns nnd in Gegensatz zn dieser Lehre, welche die
Entstehung der endemischen Arten aus Umbildung der arktischen
ableiten möchte, aber für unseren gegenwärtigen Zweck genügt es
zn zeigen, dass auch die Migrationshypothese diese Erscheinungen
zu erklären im Stande ist. . Aus meinen Verzeichnissen entnehme
ich, dass in zehn grösseren Gattungen ¿¡^ [j^ Alpen zusammen
140 Arten zählen, über ein Drittel (48) daselbst endemisch ist,
die übrigen (92), vorausgesetzt dass sie nicht, wie die Saxifragen,
mehrfache Centren besitzen, als von diesem Gebirge ursprünglich
ausgegangen betrachtet werden können. Es wurden hiebei einige
grosse Gattungen absichtlich ausgeschlossen, die in den Alpen zwar
ebenfalls reich an Arten sind, aber von anderen Vegetationscentren
in dieser Beziehung übertroifen werden oder überhaupt an vielen
entlegenen Orten durch besondere Arten vertreten sind. Die Seggen
{Carex} bilden die grösste Gattung unter den arktischen Gefässpflanzen,
und hier ist die Verbreitung zn den Alpen einem besonderen
Verhältniss unterworfen. Von den nordischen Arten (19) kehrt
die grosse Mehrzahl (15) in der alpinen Region der mitteleuropäischen
Gebirge wieder, wo sie znm Theil nur an einzelnen Standorten gefunden
werden. Ausserdem bewohnen fast ebenso viele Seggen (16)
die alpine Region^ die der arktischen Flora fehlen, aber diese Gattung
Vegetationscentren der Alpen. 217
ist nicht auf besondere geographische Centren beschränkt. Bei der
Vergleichung finde ich, dass die arktischen Arten vorzugsweise auf
feuchten Standorten wachsen, die alpinen dem trockenen Boden angehören,
und ähnliche Verhältnisse sind auch bei den meisten Saxifragen
massgebend, bei denen wir ebenfalls ein arktisches von einem
alpinen Centrum unterscheiden können. Hiedurch sehe ich die beiden,
schon bei den Regionen erwähnten Ergebnisse von Christes
Untersuchung bestätigt, dass die Wanderung der arktisch-alpinen
Gewächse sowohl von Süden nach Norden, als auch in umgekehrter
Richtung stattfand, und dass sie durch den Einfluss des feuchteren
Bodens begünstigt worden ist. Der Bau der Alpen bietet zu Versumpfungen
desselben selten einen Anlass, die Ebenen der Fjelde
und der arktischen Zone haben eine träge Wassercirculation, und
diesem Gegensatze physischer Bedingungen scheint es zu entsprechen,
dass im hohen Norden vorzugsweise Gewächse der feuchten Standorte
entstanden sind, die "sich von hier aus nach Süden verbreiteten,
und dass hingegen die Alpen durch die Mannigfaltigkeit von Pflanzen
trockenen Felsbodens hervorragen. Die Zwergbirke Norwegens findet
sich in einzelnen Sümpfen des Harzes und der Sudeten, aber so
allgemein sie in die feuchten Niederungen Russlands eindringt, so
bleibt sie doch den Alpen fast gänzlich fremd, obgleich sie zu Wanderungen
hinlänglich befähigt war, um den Jura und die bayerische
Hochebene zu erreichen.
Die Anordnung der Pflanzen in den Alpen selbst ist in viel geringerem
Grade durch die klimatischen Bedingungen und durch die
geognostische Unterlage, als durch die ursprüngliche Vertheilung
ihrer Vegetationscentren geregelt. Zuccarini war der Erste, der
dieses Verhältniss in dem Gegensatze der Flora der Ost- und Westalpen
erkannt hat. Er zählte eine Reihe von Pflanzen auf, deren
Wohngebiete in Tirol durch die Thäler der Eisack und Etsch geschieden
sind, und von denen er annahm, dass die westlichen von
dem Orteies, die östlichen vom Glockner aus sich ausgebreitet haben,
ohne jenen Einschnitt des Gebirgs überschreiten zu können. Diesen
Andeutungen liegen allgemeinere Erscheinungen zu Grunde. Durch
eine grosse Anzahl von endemischen Erzeugnissen sind in der südlichen
Hauptkette die westlichen und östlichen Theile der Alpen von
einander abgesondert, in der Centraikette bieten die in der Mitte
I'
• . i :
( ' I J
I !