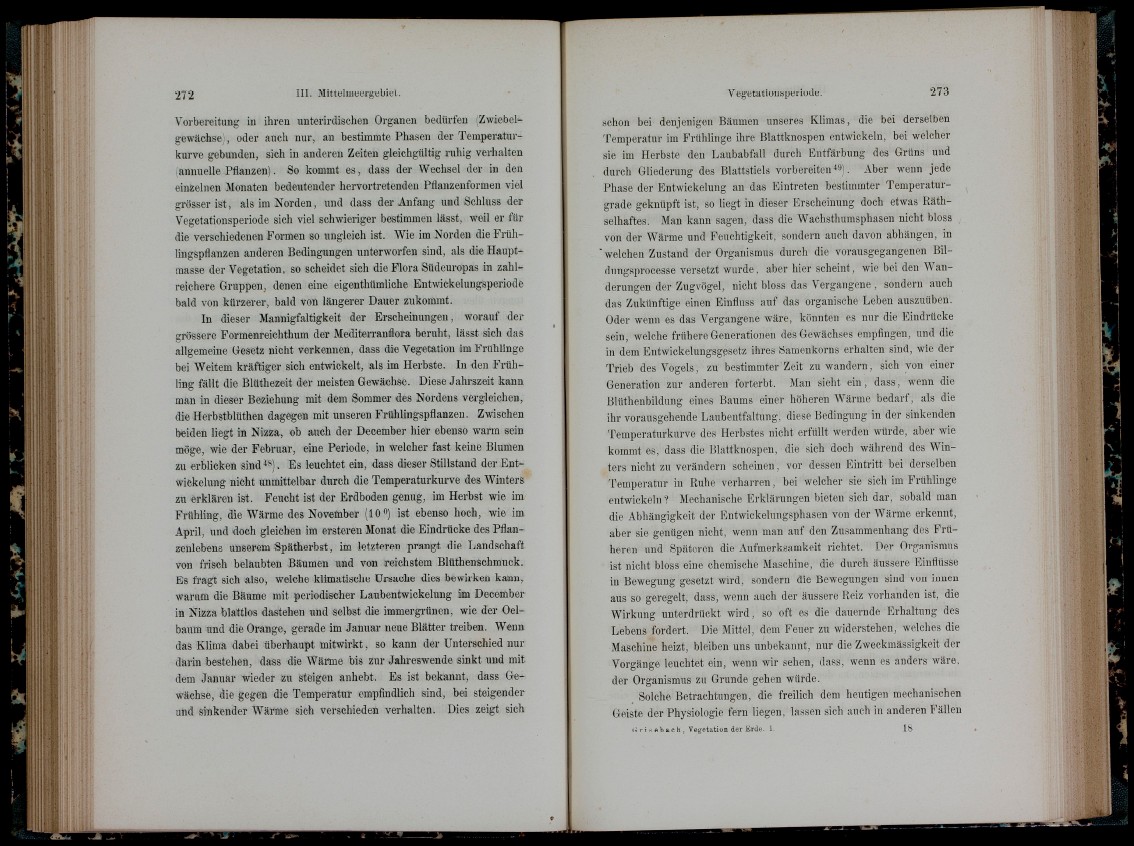
Ii
N JUffi
IUI
• 't-l
1
it
272 III. Mittelmeergebiet.
Vorbereitung in ihren unterirdischen Organen bedürfen (Zwiebelgewächse)
, oder auch nur, an bestimmte Phasen der Temperaturkurve
gebunden, sich in anderen Zeiten gleichgültig ruhig verhalten
^annuelle Pflanzen). So kommt es, dass der Wechsel der in den
einzelnen Monaten bedeutender hervortretenden Pflanzenformen viel
grösser ist, als im Norden, und dass der Anfang und Schluss der
Vegetationsperiode sich viel schwieriger bestimmen lässt, weil er für
die verschiedenen Formen so ungleich ist. Wie im Norden die Frühlingspflanzen
anderen Bedingungen unterworfen sind, als die Hauptmasse
der Vegetation, so scheidet sich die Flora Südeuropas in zahli
eichere Gruppen, denen eine eigenthümliche Entwickelungsperiode
bald von kürzerer, bald von längerer Dauer zukommt.
In dieser Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, worauf der
grössere Formenreichthum der Mediterranflora beruht, lässt sich das
allgemeine Gesetz nicht verkennen, dass die Vegetation im Frühlinge
bei Weitem kräftiger sich entwickelt, als im Herbste. In den Frühling
fällt die Blüthezeit der meisten Gewächse. Diese Jahrszeit kann
man in dieser Beziehung mit dem Sommer des Nordens vergleichen,
die Herbstblüthen dagegen mit unseren Frühlingspflanzen. Zwischen
beiden liegt in Nizza, ob auch der December hier ebenso warm sein
möge, wie der Februar, eine Periode, in welcher fast keine Blumen,
zu erblicken sind . Es leuchtet ein, dass dieser Stillstand der Entwicklung
nicht unmittelbar durch die Temperaturkurve des Wintere
zu erklären ist. Feucht ist der Erdboden genug, im Herbst wie im
Frühling, die Wärme des Novetober (10«) ist ebenso hoch, wie im
April, und doch gleichen im ersteren Monat die Eindrücke des Pflanzenlebens
unserem Spätherbst, im letzteren prangt die Landschaft
von frisch beläubten Bäumen und von mchstem Blüthenschmuck.
Es fi-agt sich also, welche kliinatische Ursache dies bewirken kann,,
warum die Bäiime mit periodischer Laubentwickelung iin December
in Nizza blättlos dastehen und selbst die immergrünen, wie der Oelbaum
und die Orange, gerade im Januar neue Blätter treiben. Wenn
das Klima dabei überhaupt mitwirkt, so kann der Unterschied nur
darin bestehen, da«s die Wärme bis zur Jahreswende sinkt und mit
dem Januar wieder zw steigen anhebt. Es ist bekannt, dass Gewächse,
die gegen die Temperatur empfindlich sind, bei steigender
und sinkender Wärme sich verschieden verhalten. Dies zeigt sich
V egetationsperiode. 273
schon bei denjenigen Bäumen unseres Klimas, die bei derselben
Temperatur im Frühhnge ihre Blattknospen entwickeln, bei welcher
sie im Herbste den Laubabfall durch Entfärbung des Grüns und
durch Gliederung des Blattstiels vorbereiten49). Aber wenn jede
Phase der Entwickelung an das Eintreten bestimmter Temperaturgrade
geknüpft ist, so liegt in dieser Erscheinung doch etwas Räthselhaftes.
Man kann sagen, dass die Wachsthumsphasen nicht bloss
von der Wärme und Feuchtigkeit, sondern auch davon abhängen, in
" welchen Zustand der Organismus durch die vorausgegangenen Bildungsprocesse
versetzt wurde, aber hier scheint, wie bei den Wanderungen
der Zugvögel, nicht bloss das Vergangene , sondern auch
das Zukünftige einen Einfluss auf das organische Leben auszuüben.
Oder wenn es das Vergangene wäre, könnten es nur die Eindrücke
sein, welche frühere Generationen des Gewächses empfingen, und die
in dem Entwickelungsgesetz ihres Samenkorns erhalten sind, wie der
Trieb des Vogels, zu bestimmter Zeit zu wandern, sich von einer
Generation zur anderen forterbt. Man sieht ein, dass, wenn die
Blüthenbildung eines Baums einer höheren Wärme bedarf, als die
ihr vorausgehende Laubentfaltung, diese Bedingung in der sinkenden
Temperaturkurve des Herbstes nicht erfüllt werden würde, aber wie
kommt es, dass die Blattknospen, die sich doch während des Winters
nicht zu verändern scheinen, vor dessen Eintritt bei derselben
Temperatur in Ruhe verharren, bei welcher sie sich im Frühliiige
entwickeln ? Mechanische Erklärungen bieten sich dar, sobald man
die Abhängigkeit der Entwickelungsphasen von der Wärme erkennt,
aber sie genügen nicht, wenn man auf den Zusammenhang des Früheren
und Späteren die Aufmerksamkeit richtet. Der Organismus
ist nicht bloss eine chemische Maschine, die durch äussere Einflüsse
in Bewegung gesetzt wird, sondern die Bewegungen sind von innen
aus so geregelt, dass, wenn auch der äussere Reiz vorhanden ist, die
Wirkung unterdrückt wird, so oft es die dauernde Erhaltung des
Lebens fordert. Die Mittel, dem Feuer zu widerstehen, welches die
Maschine heizt, bleiben uns unbekannt, nur die Zweckmässigkeit der
Vorgänge leuchtet ein, wenn wir sehen, dass, wenn es anders wäre,
der Organismus zu Grunde gehen würde.
Solche Betrachtungen, die freilich dem heutigen mechanischen
Geiste der Physiologie fern liegen, lassen sich auch in anderen Fällen
GriseV» a c h , Vegetation der Erde. 1. 18