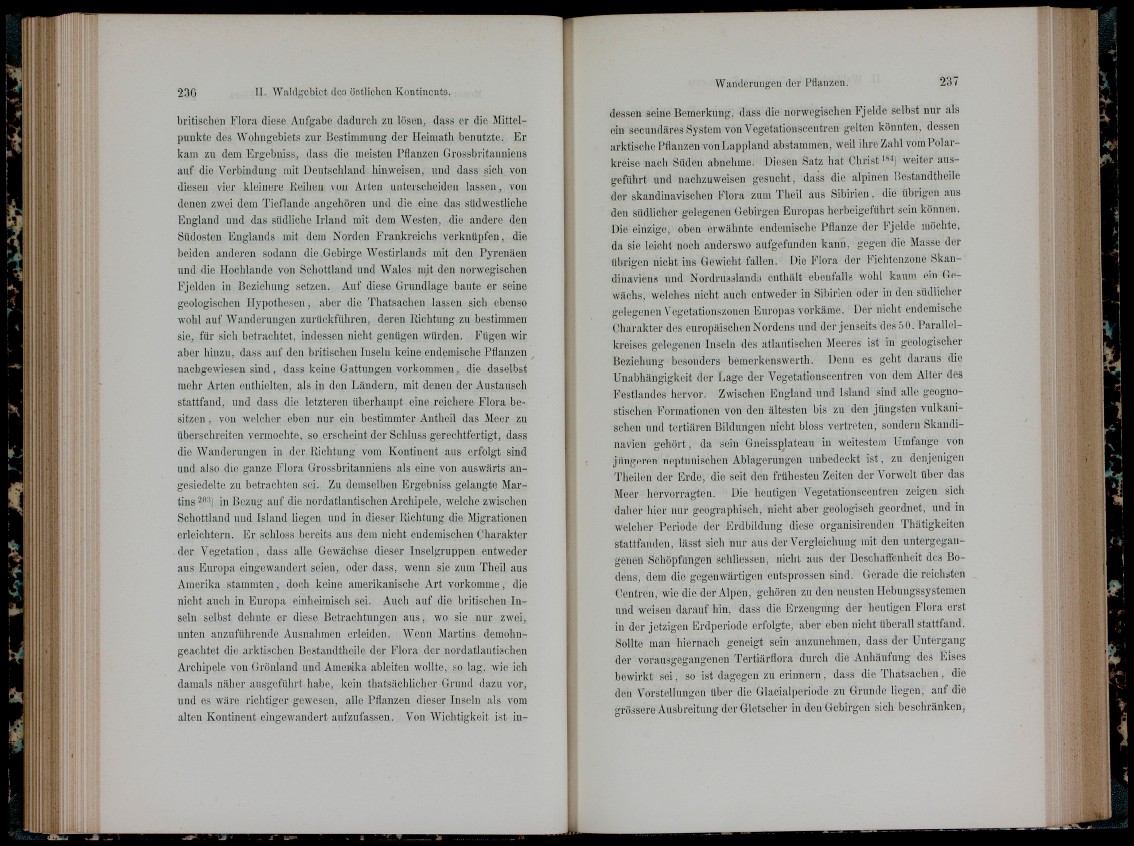
mx
!|H ;
j|
. t
i. .
H' 1l
K l
M
236 II. Waldiiebiet des östlichen Kontinents.
britischen Flora diese Aufgabe dadnrcli zu lösen, dass er die Mittelpxmkte
des Wohngebiets zur Bestimmung der Heimath benutzte. Er
kam zu dem Ergebniss, dass die meisten Pflanzen Grossbritanniens
auf die Verbindung mit üeutscliland hinweisen, und dass sich von
diesen vier kleinere Reihen von Arten unterscheiden lassen, von
denen zwei dem Tieflande angehören und die eine das südwestliche
England und das südliche Irland mit dem Westen, die andere den
Südosten Englands mit dem Norden Frankreichs verknüpfen ^ die
beiden anderen sodann die .Gebirge Westirlands mit den Pyrenäen
und die Hochlande von Schottland und Wales mit den norwegischen
Fjelden in Beziehung setzen. Auf diese Grundlage baute er seine
geologischen Hypothesen, aber die Thatsachen lassen sich ebenso
wohl auf Wanderungen zurückführen, deren Richtung zu bestimmen
siC; für sich betrachtet, indessen nicht genügen würden. Fügen wir
aber hinzu, dass auf den britischen Inseln keine endemische Pflanzen
nachgewiesen sind, dass keine Gattungen vorkommen, die daselbst
mehr Arten enthielten, als in den Ländern, mit denen der Austausch
stattfand, und dass die letzteren überhaupt eine reichere Flora besitzen
, von welcher eben nur ein bestimmter Antheil das Meer zu
überschreiten vermochte, so erscheint der Schluss gerechtfertigt, dass
die Wanderungen in der Richtung vom Kontinent aus erfolgt sind
und also die ganze Flora Grossbritanniens als eine von auswärts angesiedelte
zu betrachten sei. Zu demselben Ergebniss gelangte Martins
in Bezug auf die nordatlantischen Archipele, welche zwischen
Schottland und Island liegen und in dieser Richtung die Migrationen
erleichtern. Er schloss bereits aus dem nicht endemischen Charakter
der Vegetation , dass alle Gewächse dieser Inselgruppen entweder
aus Europa eingewandert seien, oder dass, wenn sie zum Theil aus
Amerika stammten, doch keine amerikanische Art vorkomme, die
nicht auch in Europa einheimisch sei. Auch auf die britischen Inseln
selbst dehnte er diese Betrachtungen aus, wo sie nur z\vei,
unten anzuführende Ausnahmen erleiden. AVenn Martins demohngeachtet
die arktischen Bestandtheile der Flora der nordatlautischen
Archipele von Grönland und Amei^ika ableiten wollte, so lag, wie ich
damals näher ausgeführt habe, kein thatsächlicher Grund dazu vor,
und es wäre richtiger gewesen, alle Pflanzen dieser Inseln als vom
alten Kontinent eingewandert aufzufassen. Von Wichtigkeit ist in-
Wanderungen der Pflanzen. 237
dessen seine Bemerkung, dass die norwegischen Fjelde selbst nur als
ein secundäres System von Vegetationscentren gelten könnten, dessen
arktische Pflanzen von Lappland abstammen, weil ihre Zahl vomPolarkreise
nach Süden abnehme. Diesen Satz hat Christ ^veiter ausgeführt
und nachzuweisen gesucht, dass die alpinen Bestandtheile
der skandinavischen Flora zum Theil ans Sibirien, die übrigen aus
den südlicher gelegenen Gebirgen Europas herbeigeführt sein können.
Die einzige, oben erwähnte endemische Pflanze der Fjelde möchte,
da sie leicht noch anderswo aufgefunden kann, gegen die Masse der
übrigen nicht ins Gewicht fallen. Die Flora der Fichtenzone Skandinaviens
und Nordrusslands enthält ebenfalls wohl kaum ein Gewächs,
welches nicht auch entweder in Sibirien oder in den südlicher
gelegenen Vegetationszonen Europas vorkäme. Der nicht endemische
Charakter des europäischen Nordens und der jenseits des 50. Parallelkreises
gelegenen Inseln des atlantischen Meeres ist in geologischer
Beziehung besonders bemerkenswerth. Denn es geht daraus die
Unabhängigkeit der Lage der Vegetationscentren von dem Alter des
Festlandes hervor. Zwischen England und Island sind alle geognostischen
Formationen von den ältesten bis zu den jüngsten vulkanischen
und tertiären Bildungen nicht bloss vertreten, sondern Skandinavien
gehört, da sein Gneissplateau in weitestem Umfange von
jüngeren neptunischen Ablagerungen unbedeckt ist, zu denjenigen
Theilen der Erde, die seit den frühesten Zeiten der Vorwelt über das
Meer hervorragten. Die heutigen Vegetationscentren zeigen sich
daher hier nur geogi'aphisch, nicht aber geologisch geordnet, und in
welcher Periode der Erdbildung diese organisirenden Thätigkeiten
stattfanden, lässt sich nur aus der Vergleichung mit den untergegangenen
Schöpfungen schliessen, nicht aus der Beschaffenheit des Bodens,
dem die gegenwärtigen entsprossen sind. Gerade die reichsten
Centren, wie die der Alpen, gehören zu den neusten Hebungssystemen
und weisen darauf hin, dass die Erzeugung der heutigen Flora erst
in der jetzigen Erdperiode erfolgte, aber eben nicht überall stattfand.
Sollte man hiernach geneigt sein anzunehmen, dass der Untergang
der vorausgegangenen Tertiärflora durch die Anhäufung des Eises
bewirkt sei, so ist dagegen zu erinnern, dass die Thatsachen, die
den Vorstellungen über die Glacialperiode zu Grunde liegen, auf die
grössere Ausbreitung der Gletscher in den Gebirgen sich beschränken,
•1