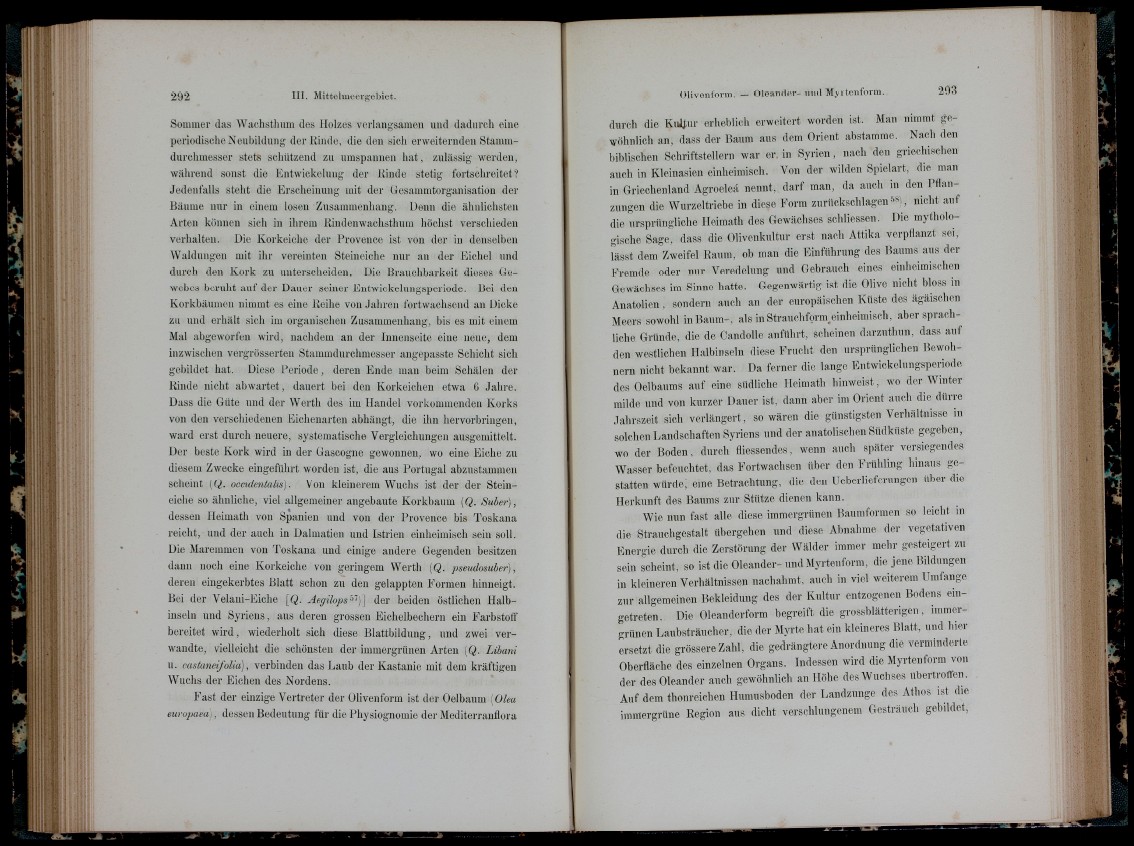
'4 t
.1
i
ta
ii: i '
^ I
i
i
292 III. Mittelmeei-g-ebiet.
Sommer das Wachsthum des Holzes verlangsamen und dadurch eine
periodische Neubildxing der Rinde, die den sich erweiternden Stammdurchniesser
stets schützend zu umspannen hat, zulässig werden,
während sonst die Entwickelung der Kinde stetig fortschreitet?
Jedenfalls steht die Erscheinung mit der Gesammtorganisation der
Bäume nur in einem losen Zusammenhang. Denn die ähnlichsten
Arten können sich in ihrem ßindenwachsthum höchst verschieden
verhalten. Die Korkeiche der Provence ist von der in denselben
Waldungen mit ihr vereinten Steineiche nur an der Eichel und
durch den Kork zu untersclieiden. Die Brauchbarkeit dieses Gewebes
beruht auf der Dauer seiner Entwickelungsperiode. Bei den
Korkbäumen nimmt es eine ßeihe von Jahren fortwachsend an Dicke
zu und erhält sich im organischen Zusammenhang, bis es mit einem
Mal abgeworfen wird, nachdem an der Innenseite eine neue, dem
inzwischen vergrösserten Stammdurchmesser angepasste Schicht sich
gebildet hat. Diese Periode, deren Ende man beim Schälen der
Rinde nicht abwartet, dauert bei den Korkeichen etwa 6 Jahre.
Dass die Güte und der Werth des im Handel vorkommenden Korks
von den verschiedenen Eichenarten abhängt, die ihn hervoi-bringen,
ward erst durch neuere, systematische Vergieichungen ausgemittelt.
Der beste Kork wird in der Gascogne gewonnen, wo eine Eiche zu
diesem Zwecke eingeführt worden ist, die aus Portugal abzustammen
sclieint [ Q . o c c i d e n i a l i s ) . Von kleinerem Wuchs ist der der Steineiche
so ähnliche, viel allgemeiner angebaute Korkbaum (Q. S u h e r ) ,
dessen Heimath von Spanien und von der Provence bis Toskana
reicht, und der auch in Dalmatien und Istrien einheimisch sein soll.
Die Maremmen von Toskana und einige andere Gegenden besitzen
dann noch eine Korkeiche von geringem Werth [ Q . p s e u d o s u b e r ) ,
deren eingekerbtes Blatt schon zu den gelappten Formen hinneigt.
Bei der Velaui-Eiche [Q. A e g i l o p s ' ' > ' ^ ) \ der beiden östlichen Halbinseln
und Syriens, aus deren grossen Eichelbechern ein Farbstoff
bereitet wird, wiederholt sich diese Blattbildung, und zwei verwandte,
vielleicht die schönsten der immergrünen Arten (Q. L i b a n i
u. c a s t a n m f o U a ) , verbinden das Laub der Kastanie mit dem kräftigen
Wuchs der Eichen des Nordens.
Fast der einzige Vertreter der Olivenform ist der Oelbaum [ O l e a
e u r o p a e a ) , dessen Bedeutung für die Physiognomie der Mediterranflora
Olivenform. — Oleander- und Myrtenform. 293
durch die KuJjiur erheblich erweitert worden ist. Man nimmt gewöhnlich
an, dass der Baum aus dem Orient abstamme. Nach den
biblischen Schriftstellern war er. in Syrien, nach den griechischen
auch in Kleinasien einheimisch. Von der wilden Spielart, die man
in Griechenland Agroeleä nennt, darf man, da auch in den Pflanzungen
die Wurzeltriebe in diese Form zurückschlagen , nicht auf
die ursprüngliche Heimath des Gewächses schliessen. Die mythologische
Sage, dass die Olivenkultur erst nach Attika verpflanzt sei,
lässt dem Zweifel Raum, ob man die Einführung des Baums aus der
Fremde oder nur Veredelung und Gebrauch eines einheimischen
Gewächses im Sinne hatte. Gegenwärtig ist die Olive nicht bloss in
Anatolien , sondern auch an der europäischen Küste des ägäischen
Meers sowohl in Baum-, als in Strauchform, einheimisch, aber sprachliche
Gründe, die de Candolle anführt, scheinen darzuthun, dass auf
den westlichen Halbinseln diese Frucht den ursprünglichen Bewohnern
nicht bekannt war. Da ferner die lange Entwickelungsperiode
des Oelbaums auf eine südliche Heimath hinweist, wo der Winter
milde und von kurzer Daner ist, dann aber im Orient auch die dürre
Jahrszeit sich verlängert, so wären die günstigsten Verhältnisse in
solchen Landschaften Syriens und der anatolischen Südküste gegeben,
wo der Boden, durch fliessendes, wenn auch später versiegendes
Wasser befeuchtet, das Fortwachsen über den Frühling hinaus gestatten
würde, eine Betrachtung, die den Ueberlieferungen über die
Herkunft des Baums zur Stütze dienen kann.
Wie nun fast alle diese immergrünen Baumformen so leicht in
die Strauchgestalt übergehen und diese Abnahme der vegetativen
Energie durch die Zerstörung der Wälder immer mehr gesteigert zu
sein scheint, so ist die Oleander- und Myrtenform, die jene Bildungen
in kleineren Verhältnissen nachahmt, auch in viel weiterem Umfange
zur allgemeinen Bekleidung des der Kultur entzogenen Bodens eingetreten.
Die Oleanderform begreift die grossblätterigen, immergrünen
Laubsträucher, die der Myrte hat ein kleineres Blatt, und hier
ersetzt die grössere Zahl, die gedrängtere Anordnung die verminderte
Oberfläche des einzelnen Organs. Indessen wird die Myrtenform von
der des Oleander auch gewöhnlich an Höhe des Wuchses übertroffen.
Auf dem thonreichen Humusboden der Landzunge des Athos ist die
immergrüne Region aus dicht verschlungenem Gesträuch gebildet,
• i .']••'.
•i . '•!(', .1; '
h
• i . t--
1