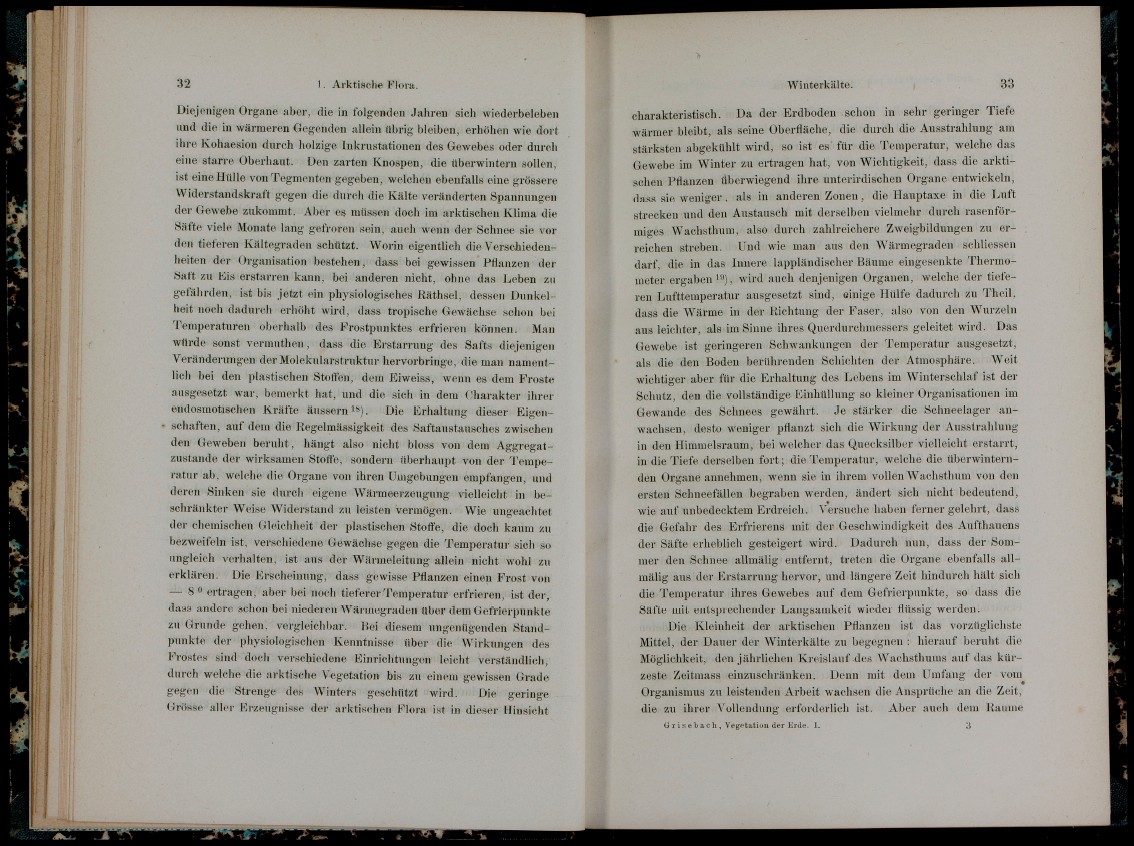
32 1. Arktisclie Flora. Winterkälte. 33
n': Ä
i ^
. H f
: il
i
Diejenigen Organe aber, die in folgenden Jahren sich wiederbeleben
und die in wärmeren Gegenden allein übrig bleiben, erhöhen wie dort
ihre Kohaesion durch holzige Inkrustationen des Gewebes oder durcli
eine starre Oberhaut. Den zarten Knospen, die überwintern sollen,
ist eine Hülle vonTegmenten gegeben, welchen ebenfalls eine grössere
Widerstandskraft gegen die durch die Kälte veränderten Spannungen
der Gewebe zukommt. Aber es müssen doch im arktischen Klima die
Säfte viele Monate lang gefroren sein, auch wenn der Schnee sie vor
den tieferen Kältegraden schützt. Worin eigentlich die Verschiedenheiten
der Organisation bestehen, dass bei gewissen Pflanzen der
Saft zu Eis erstarren kann, bei anderen nicht, ohne das Leben zu
gefährden, ist bis jetzt ein physiologisches Käthsel, dessen Dunkellieit
noch dadurch eriiöht wird, dass tropische Gewächse schon bei
Temperaturen oberhalb des Frostpunktes erfrieren können. Man
würde sonst vermuthen, dass die Erstarrung des Safts diejenigen
Veränderungen der Molekularstruktur hervorbringe, die man namentlich
bei den plastischen Stoffen, dem Eiweiss, wenn es dem Froste
ausgesetzt war, bemerkt hat, und die sich in dem Charakter ihrer
endosmotischen Kräfte äussern i»). Die Erhaltung dieser Eigenschaften,
auf dem die Regelmässigkeit des Saftaustausches zwischen
den Geweben beruht, hängt also nicht bloss von dem Aggregatzustande
der wirksamen Stoffe, sondern überhaupt von der Temperatur
ab, welche die Organe von ihren Umgebungen empfangen, und
deren Sinken sie durcli eigene Wärmeerzeugung vielleicht in beschränkter
Weise Widerstand zu leisten vermögen. Wie ungeachtet
der chemischen Gleichheit der plastischen Stoff'e, die doch kaum zu
bezweifeln ist, verschiedene Gewächse gegen die Temperatur sich so
ungleich verhalten, ist aus der Wärmeleitung allein nicht wohl zu
erklären. Die Erscheinung, dass gewisse Pflanzen einen Frost von
— 8 0 ertragen, aber bei noch tieferer Temperatur erfrieren, ist der,
dass andere schon bei niederen Wärmegraden über dem Gefrierpunkte
zu Grunde gehen, vergleichbar. Bei diesem ungenügenden Standpunkte
der physiologischen Kenntnisse über die Wirkungen des
Frostes sind doch verschiedene Einrichtungen leicht verständlich,
durch welche die arktische Vegetation bis zu einem gewissen Grade
gegen die Strenge des Winters geschützt wird. Die geringe
Grösse aller Erzeugnisse der arktischen Flora ist in dieser Hinsicht
charakteristisch. Da der Erdboden schon in sehr geringer Tiefe
wärmer bleibt, als seine Oberfläche, die durch die Ausstrahlung am
stärksten abgekühlt wird, so ist es für die Temperatur, welche das
Gewebe im Winter zu ertragen hat, von Wichtigkeit, dass die arktischen
Pflanzen überwiegend ihre unterirdischen Organe entwickeln,
dass sie weniger, als in anderen Zonen, die Hauptaxe in die Luft
strecken und den Austausch mit derselben vielmehr durch rasenförmiges
Wachsthum, also durch zahlreichere Zweigbildungen zu erreichen
streben. Und wie man aus den Wärmegraden schliessen
darf, die in das Innere lappländischer Bäume eingesenkte Thermometer
ergaben wird auch denjenigen Organen, welche der tieferen
Lufttemperatur ausgesetzt sind, einige Hülfe dadurch zu Theil,
dass die Wärme in der Richtung der Faser, also von den Wurzeln
aus leichter, als im Sinne ihres Querdurchmessers geleitet wird. Das
Gewebe ist geringeren Schwankungen der Temperatur ausgesetzt,
als die den Boden berührenden Schichten der Atmosphäre. Weit
wichtiger aber für die Erhaltung des Lebens im Winterschlaf ist der
Schutz, den die vollständige Einhüllung so kleiner Organisationen im
Gewände des Schnees gewährt. J e stärker die Schneelager anwachsen,
desto weniger pflanzt sich die Wirkung der Ausstrahlung
in den Himmelsraum, bei welcher das Quecksilber vielleicht erstarrt,
in die Tiefe derselben fort; die Temperatur, welche die überwinternden
Organe annehmen, wenn sie in ihrem vollen Wachsthum von den
ersten Schneefällen begraben werden, ändert sich nicht bedeutend,
wie auf unbedecktem Erdreich. Versuche haben ferner gelehrt, dass
die Gefahr des Erfrierens mit der Geschwindigkeit des Aufthauens
der Säfte erheblich gesteigert wird. Dadurch nun, dass der Sommer
den Schnee allmälig entfernt, treten die Organe ebenfalls allmälig
aus der Erstarrung hervor, und längere Zeit hindurch hält sich
die Temperatur ihres Gewebes auf dem Gefrierpunkte, so dass die
Säfte mit entsprechender Langsamkeit wieder flüssig werden.
Die Kleinheit der arktischen Pflanzen ist das vorzüglichste
Mittel, der Dauer der Winterkälte zu begegnen : hierauf beruht die
Möglichkeit, den jährlichen Kreislauf des Wachsthums auf das kürzeste
Zeitmass einzuschränken. Denn mit dem Umfang der vom^
Organismus zu leistenden Arbeit wachsen die Ansprüche an die Zeit,
die zu ihrer Vollendung erforderlich ist. Aber auch dem Räume
Grisebach, Vegetation der Erde. L 3