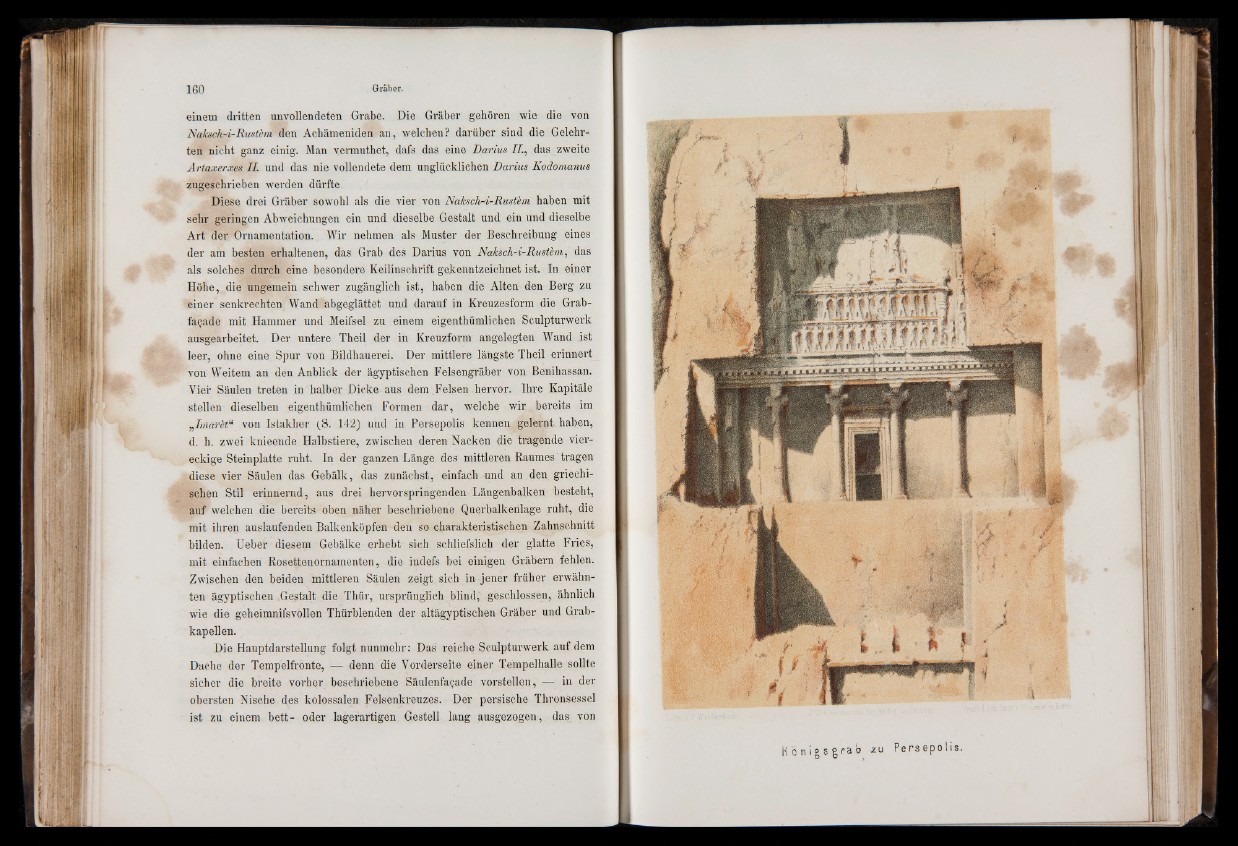
einem dritten unvollendeten Grabe. Die Gräber gehören wie die von
Naksch-i-Rustem den Achämeniden an, welchen? darüber sind die Gelehrten
nicht ganz einig. Man vermuthet, dafs das eine Darius I I , das zweite
Artaxerxes II. und das nie vollendete dem unglücklichen Darius Kodomanus
zugeschrieben werden dürfte
Diese drei Gräber sowohl als die vier von Naksch-i-Rustiim haben mit
sehr geringen Abweichungen ein und dieselbe Gestalt und ein und dieselbe
Art der Ornamentation. Wir nehmen als Muster der Beschreibung eines
der am besten erhaltenen, das Grab des Darius von Naksch-i-Rustem, das
als solches durch eine besondere Keilinschrift gekennzeichnet ist. In einer
Höhe, die ungemein schwer zugänglich ist, haben die Alten den Berg zu
einer senkrechten Wand abgeglättet und darauf in Kreuzesform die Grab-
fatjade mit Hammer und Meifsel zu einem eigenthümlichen Sculpturwerk
ausgearbeitet. Der untere Theil der in Kreuzform angelegten Wand ist
leer, ohne eine Spur von Bildhauerei. Der mittlere längste Theil erinnert
von Weitem an den Anblick der ägyptischen Felsengräber von Benihassan.
Vier Säulen treten in halber Dicke aus dem Felsen hervor. Ihre Kapitale
stellen dieselben eigenthümlichen Formen dar, welche wir bereits im
„Imaret“ von Istakher (S. 142) und in Persepolis kennen gelernt,haben,
d. h. zwei knieende Halbstiere, zwischen deren Nacken die tragende viereckige
Steinplatte ruht. In der ganzen Länge des mittleren Raumes tragen
diese vier Säulen das Gebälk, das zunächst, einfach und an den griechischen
Stil erinnernd, aus drei hervorspringenden Längenbalken besteht,
auf welchen die bereits oben näher beschriebene Querbalkenlage ruht, die
mit ihren auslaufenden Balkenköpfen den so charakteristischen Zahnschnitt
bilden. Ueber diesem Gebälke erhebt sich schliefslich der glatte Fries,
mit einfachen Rosettenornamenten, die indefs bei einigen Gräbern fehlen.
Zwischen den beiden mittleren Säulen zeigt sich in jener früher erwähnten
ägyptischen Gestalt die Thür, ursprünglich blind, geschlossen, ähnlich
wie die geheimnifsvöllen Thürblenden der altägyptischen Gräber und Grabkapellen.
Die Hauptdarstellung folgt nunmehr: Das reiche Sculpturwerk auf dem
Dache der Tempelfronte, — denn die Vorderseite einer Tempelhalle sollte
sicher die breite vorher beschriebene Säulenfa^ade vorstellen, —• in der
obersten Nische des kolossalen Felsenkreuzes. Der persische Thronsessel
ist zu einem bett- oder lagerartigen Gestell lang ausgezogen, das, von