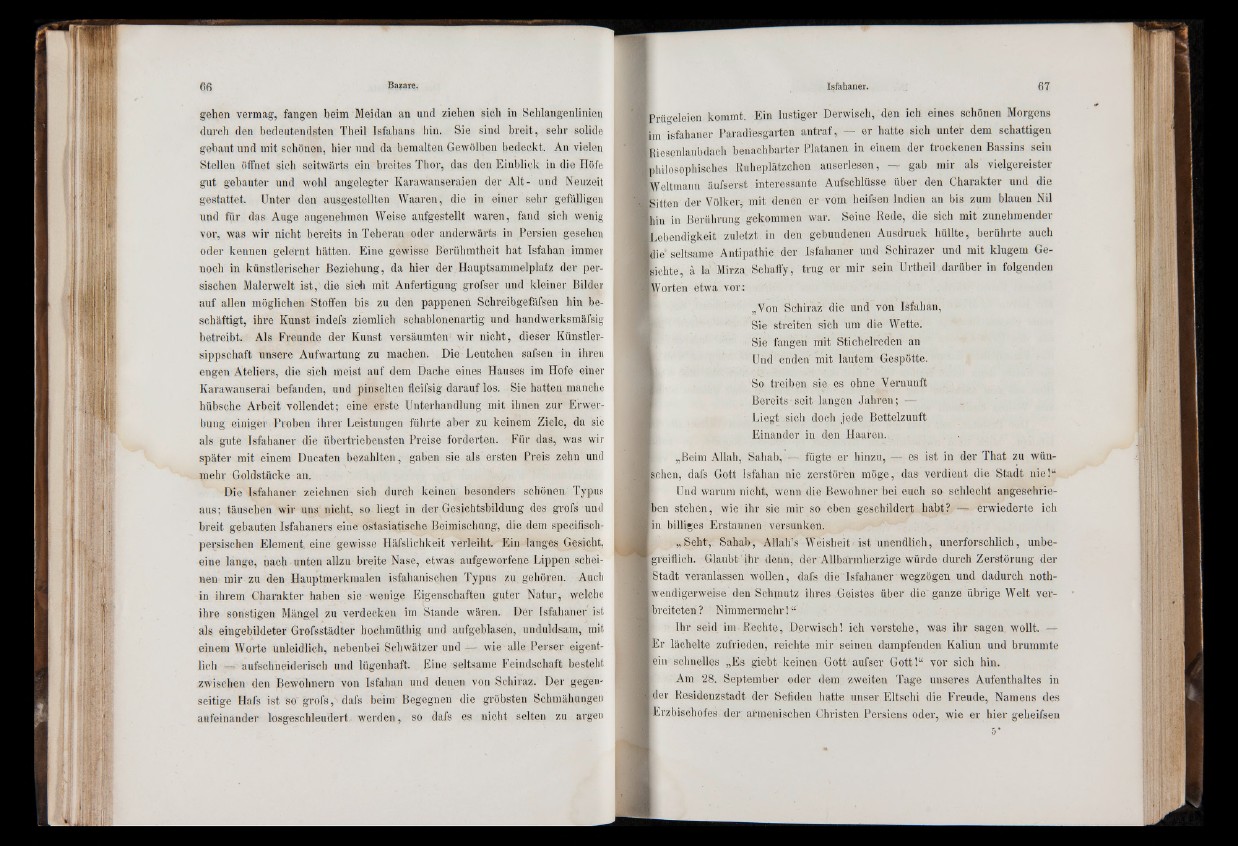
gehen vermag, fangen beim Meidan an und ziehen sich in Schlangenlinien
durch den bedeutendsten Theil Isfahans hin. Sie sind breit, sehr solide
gebaut und mit schönen, hier und da bemalten Gewölben bedeckt. An vielen
Stellen öffnet sich seitwärts ein breites Thor, das den Einblick in die Höfe
gut gebauter und wohl angelegter Karawansereien der Alt- und Neuzeit
gestattet. Unter den ausgestellten Waaren, die in einer sehr gefälligen
und für das Auge angenehmen Weise aufgestellt waren, fand sich wenig
vor, was wir nicht bereits in Teheran oder anderwärts in Persien gesehen
oder kennen geleimt hätten. Eine gewisse Berühmtheit hat Isfahan immer
noch in künstlerischer Beziehung, da hier der Hauptsammelplatz der persischen
Malerwelt ist, die sich mit Anfertigung grofser und kleiner Bilder
auf allen möglichen Stoffen bis zu den pappenen Schreibgefäfsen hin beschäftigt,
ihre Kunst indefs ziemlich schablonenartig und handwerksmäfsig
betreibt. Als Freunde der Kunst versäumten1 wir nicht, dieser Künstlersippschaft
unsere Aufwartung zu machen. Die Leutchen safsen in ihren
engen Ateliers, die sich meist auf dem Dache eines Hauses im Hofe einer
Karawanserai befanden, und pinselten fleifsig darauf los. Sie hatten manche
hübsche Arbeit vollendet; eine erste Unterhandlung mit ihnen zur Erwerbung
einiger Proben ihrer Leistungen führte aber zu keinem Ziele, da sie
als gute Isfahaner die übertriebensten Preise forderten. Für das, was wir
später mit einem Ducaten bezahlten, gaben sie als ersten Preis zehn und
mehr Goldstücke an.
Die Isfahaner zeichnen sich durch keinen besonders schönen, Typus
aus; täuschen wir uns nicht, so liegt in der Gesichtsbildung des grofs und
breit gebauten Isfahaners eine ostasiatische Beimischung, die dem specifisch-
persischen Element eine gewisse Häfsliehkeit verleiht. Ein langes Gesicht,
eine lange, nach unten allzu breite Nase, etwas aufgeworfene Lippen scheinen
mir zu den Hauptmerkmalen isfahanischen Typus zu gehören. Auch
in ihrem Charakter haben sie wenige Eigenschaften guter Natur, welche
ihre sonstigen Mängel zu verdecken im Stande wären. Der Isfahaner ist
als eingebildeter Grofsstädter hochmüthig und aufgeblasen, unduldsam, mit
einem Worte unleidlich, nebenbei Schwätzer und — wie alle Perser eigentlich
—- aufschneiderisch und lügenhaft. Eine seltsame Feindschaft besteht
zwischen den Bewohnern von Isfahan und denen von Schiraz. Der gegenseitige
Hafs ist so' grofs I* dafs beim Begegnen die gröbsten Schmähungen
aufeinander losgeschleudert werden, so dafs es nicht selten zu argen
■Prügeleien kommt. Ein lustiger Derwisch, den ich eines schönen Morgens
■ im isfahaner Paradiesgarten antraf, — er hatte sich unter dem schattigen
■Riesenlaubdach benachbarter Platanen in einem der trockenen Bassins sein
■philosophisches Ruheplätzchen auserlesen, - r gab mir als vielgereister
E v e ltm ann äufserst interessante Aufschlüsse über den Charakter und die
B s i t t e n der Völker* mit denen er -vom heifsen Indien an bis zum blauen Nil
■ h in in Berührung gekommen war. Seine Rede, die sich mit zunehmender
■Lebendigkeit zuletzt, in den gebundenen Ausdruck hüllte, berührte auch
■ d ie seltsame Antipathie der Isfahaner und Schirazer und mit klugem Ge-
■ sichte , ä la Mirza Schaffy, trug er mir sein Urtheil darüber in folgenden
■Worten etwa vor:
„Von Schiraz die und von Isfahan,
Sie streiten sich um die Wette.
Sie fangen mit Stichelreden an
Und enden mit lautem Gespötte.
So treiben sie, es ohne Vernunft
Bereits-seit langen Jahren; —
Liegt sich doch jede Bettelzunft
Einander in den Haaren. .
„Beim Allah, Sähab, — fügte er hinzu, — es ist in der That zu wün-
^■schen, dafs Gott Isfahan nie zerstören möge, das verdient die Stadt n ie !“
Und warum nicht, wenn die Bewohner bei euch so schlecht angeschrie-
■ b en stehen, wie ihr sie mir so eben geschildert habt? — erwiederte ich
■ in billiges Erstaunen versunken.
„ Seht, Sahal.K': Allabts Weisheit-ist unendlich, unerforschlich, unbe-
E ‘ ' H ‘ •_ “• |g
■greiflich. Glaubt ihr denn, der Allbarmherzige würde durch Zerstörung der
■ S ta d t veranlassen wollen, dafs die Isfahaner wegzögen und dadurch noth-
■wendigerweise den Schmutz ihres Geistes über die ganze übrige Welt verab
red e ten ? Nimmermehr! “
Ihr seid im Rechte, Derwisch! ich verstehe, was ihr sagen, wollt. —
■ E r lächelte zufrieden, reichte mir seinen dampfenden Kaliun und brummte
■ e in schnelles „Es giebt keinen Gott aufser Gott!“ vor sich hin.
Am 28. September oder dem zweiten Tage unseres Aufenthaltes in
■ d e r Residenzstadt der Sefiden hatte unser Eltschi die Freude, Namens des
■Erzbischofes der armenischen Christen Persiens oder, wie er hier geheifsen