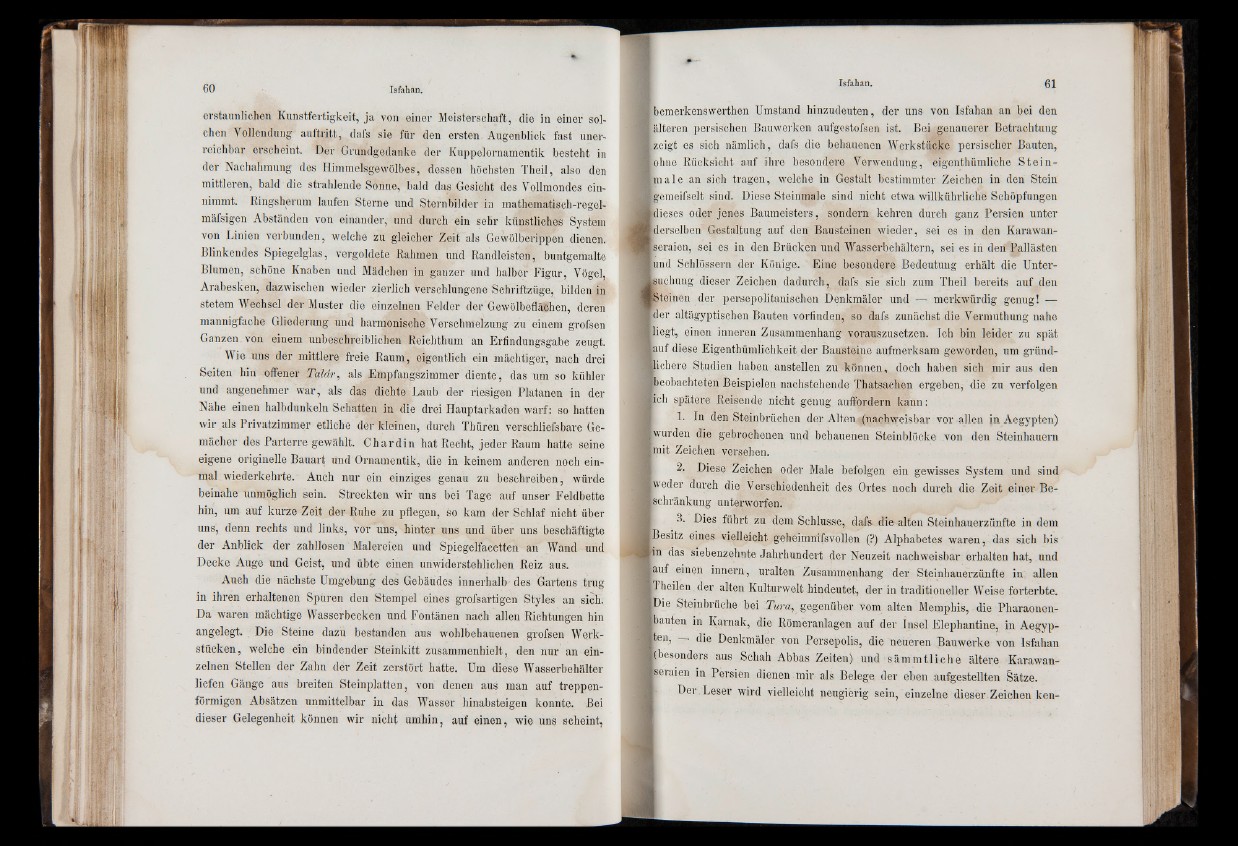
erstaunlichen Kunstfertigkeit, ja von einer Meisterschaft, die in einer solchen
Vollendung' auftritt, dafs sie für den ersten Augenblick fast unerreichbar
erscheint. Der Grundgedanke der Kuppelornamentik besteht in
der Nachahmung des Himmelsgewölbes, dessen höchsten Theil, also den
mittleren, bald die strahlende Sonne, bald das Gesicht des Vollmondes einnimmt.
Ringsherum laufen Sterne und Sternbilder in mathematisch-regel-
mäfsigen Abständen von einander, und durch ein sehr künstliches System
von Linien verbunden, welche zu gleicher Zeit als Gewölberippen dienen.
Blinkendes Spiegelglas, vergoldete Rahmen und Randleisten, buntgemalte
Blumen, schöne Knaben und Mädchen in ganzer und halber Figur, Vögel,
Arabesken, dazwischen wieder zierlich verschlungene Schriftzüge, bilden in
stetem Wechsel der Muster die einzelnen Felder der Gewölbefläbhen, deren
mannigfache Gliederung und harmonische Verschmelzung zu einem grofsen
Ganzen von einem unbeschreiblichen Reicbthum an Erfindungsgabe zeugt.
Wie uns der mittlere freie Raum, eigentlich ein mächtiger, nach drei
Seiten hin offener Talar, als Empfangszimmer diente, das um so kühler
und angenehmer war, als das dichte Laub der riesigen Platanen in der
Nähe einen halbdunkeln Schatten in die drei Hauptarkaden warf: so hatten
wir als Privatzimmer etliche der kleinen, durch Thüren verschliefsbare Gemächer
des Parterre gewählt. C h a rd in hat Recht, jeder Raum hatte seine
eigene originelle Bauart und Ornamentik, die in keinem anderen noch einmal
wiederkehrte. Auch nur ein einziges genau zu beschreiben, würde
beinahe unmöglich sein. Streckten wir uns bei Tage auf unser Feldbette
hin, um auf kurze Zeit der Ruhe zu pflegen, so kam der Schlaf nicht über
uns, denn rechts und links, vor uns, hinter uns und über uns beschäftigte
der Anblick der zahllosen Malereien und Spiegelfacetten an Wand und
Decke Auge und Geist, und übte einen unwiderstehlichen Reiz aus.
Auch die nächste Umgebung des Gebäudes innerhalb des Gartens trug
in ihren erhaltenen Spuren den Stempel eines grofsartigen Styles an sich.
Da waren mächtige Wasserbecken und Fontänen nach allen Richtungen hin
angelegt. Die Steine dazu bestanden aus wohlbehauenen grofsen Werkstücken,
welche ein bindender Steinkitt zusammenhielt, den nur an einzelnen
Stellen der Zahn der Zeit zerstört hatte. Um diese Wasserbehälter
liefen Gänge aus breiten Steinplatten, von denen aus man auf treppenförmigen
Absätzen unmittelbar in das Wasser hinabsteigen konnte. Bei
dieser Gelegenheit können wir nicht umhin, auf einen, wie uns scheint,
Ibemerkenswerthen Umstand hinzudeuten, der uns von Isfahan an bei den
■älteren persischen Bauwerken aufgestofsen ist. Bei genauerer Betrachtung
■zeigt es sich nämlich, dafs die behauenen Werkstücke persischer Bauten,
■ohne Rücksicht auf ihre besondere Verwendung, eigenthümliche S te in -
■ m a le an sich tragen, welche in Gestalt bestimmter Zeichen in den Stein
■gemeifselt sind. Diese Steinmale sind nicht etwa willkührliche Schöpfungen
■dieses oder jenes Baumeisters , sondern kehren durch ganz Persien unter
■derselben Gestaltung auf den Bausteinen wieder, sei es in den Karawan-
Iseraien, sei es in den Brücken und Wasserbehältern, sei es in den Pallästen
¡und Schlössern der Könige. Eine besondere Bedeutung erhält die Untersuchung
dieser Zeichen dadurch, dafs sie sich zum Theil bereits auf den
■Steinen der persepolitanischen Denkmäler und — merkwürdig genug! —
■ der altägyptischen Bauten vorfinden, so dafs zunächst die Vermuthung nahe
■ liegt, einen inneren Zusammenhang vorauszusetzen. Ich bin leider zu spät
■ a u f diese Eigenthümlichkeit der Bausteine aufmerksam geworden, um gründl
i c h e r e Studien haben anstellen zu können, doch haben sich mir aus den
»beobachteten Beispielen nachstehende Thatsachen ergeben, die zu verfolgen
B ich spätere Reisende nicht genug auffordern kann:
1. In den Steinbrüchen der Alten. ; (nachweisbar vor allen in Aegypten)
■wurden die gebrochenen und behauenen Steinblöcke von den Steinhauern
■ m it Zeichen versehen.
2. Diese Zeichen oder Male befolgen ein gewisses System und sind
^■veder durch die .Verschiedenheit des Ortes noch durch die Zeit einer Bes
c h r ä n k u n g unterworfen.
3. Dies führt zu dem Schlüsse, dafs. die alten Steinhauerzünfte in dem
^B e sitz eines vielleicht geheimnifsvollen (?) Alphabetes waren, das sich bis
■ m das siebenzehnte Jahrhundert der Neuzeit nachweisbar erhalten hat, und
■ a u f einen innern, uralten Zusammenhang der Steinhauerzünfte in allen
■ ’heilen der alten Kulturwelt hindeutet, der in traditioneller Weise forterbte.
■Die Steinbrüche bei Tara, gegenüber vom alten Memphis, die Pharaonen-
■bauten in Karnak, die Römeranlagen auf der Insel Elephantine, in Aegyp-
Bten, -r- die Denkmäler von Persepolis, die neueren Bauwerke von Isfahan
■(besonders aus Schah Abbas Zeiten) und s äm m tlic h e ältere Karawan-
B e ia ie n in Persien dienen mir als Belege, der eben .aufgestellten Sätze.
Der . Leser wird vielleicht neugierig sein, einzelne dieser Zeichen ken